Schlummern tuth es nie, das Netz und so declarirt das Gesetz, dasz der Mensch soll sein gehetzt. Doch der Mensch hat nur zwei Händ‘, zwei Ohren und zwei Äugelein.
So sieht er nur ein tausendstel von all den Online-Sauerein.
Und siehe da! Er steht auf und proclamieret: Ich bin süchtig. Dabei ist er nur frusthrieret.
Ich spreche bei exzessivem Gebrauch von Internet, Handy und selbst beim ständigen Daddeln von Online-Rollenspielen nicht gern von Sucht. Der Begriff Sucht ist in diesem Zusammenhang RTL-Sprache. Er ist nicht nur medizinisch veraltet, er rückt auch etwas, das eher ein Fehlverhalten ist, in die Nähe einer Drogenabhängigkeit und macht somit am Ende harmlose technische Errungenschaften zu mit Vorsicht zu genießenden Suchtmitteln, deren Gebrauch strengstens kontrolliert werden muss. Natürlich gibt es auf der Seite Onlinesucht.de eine ganze Menge Berichte von Menschen, denen ihr Umgang mit dem Netz außer Kontrolle geraten ist, und selbstverständlich heißen diese Berichte Bekenntnisse. Aber wenn man denn unbedingt einen Vergleich ziehen muss zu den klassischen Drogenkrankheiten, dann erinnern die Berichte doch am ehesten an die von zwanghaften Spielern. Bloß, dass die ominöse Onlinesucht nicht mit dem finanziellen Ruin verbunden ist, blasse Haut ist eher die Folge.
Verharmlosung!, rufen da die Ersten, denn nichts ist in einer hysterischen Zeit schlimmer, als den Ball flach zu halten. Aber Entschuldigung: die Folgen auch noch der massivsten WoW-Sucht sind überwunden in dem Moment, in dem man den Stecker zieht. Versuchen Sie das mal mit Heroin. Den Begriff Sucht für jede erdenkliche Tätigkeit zu verwenden, die man öfter ausübt als Duschen, ist einfach eine bequeme Möglichkeit, sich selbst aus der Verantwortung zu entlassen. „Bin halt süchtig“, sagt der Fremdgeher, „Ich kann nicht anders“, sagt der gerade nochmal kurz die Mails Checkende, „Die Sucht ist stärker als ich“, ruft es aus dem Computerraum.
Unfug. Medizinisch ist das Onlinesein ganz harmlos.
Aber ich hasse Menschen, die surfen, während sie mit mir reden.
Was ich natürlich meine: Ich hasse Menschen, die surfen, während sie mit mir zu reden vorgeben.
Nein, ich bitte um Verzeihung: Ich hasse Menschen, die surfen, während ihre bleiche leere Hülle vor mir sitzt und den Anschein erweckt, hier handele es sich um ein Gespräch.
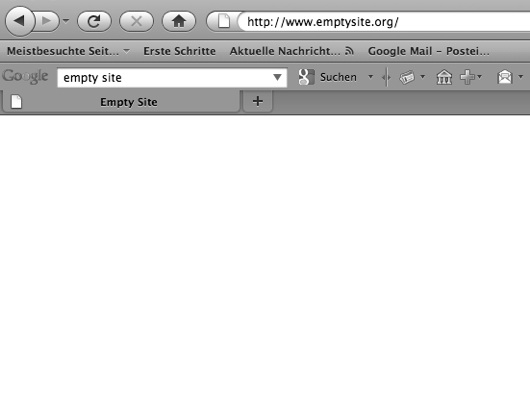
Mit einem ehemaligen Chef hatte ich innerhalb mehrerer Jahre eine einzige sinnvolle Unterhaltung. Sie ging etwa fünf, vielleicht sogar beinahe zehn Minuten lang, wir saßen in einem Café und er hatte aus unerfindlichen Gründen seinen Laptop nicht dabei.
Üblicherweise schaute er nur von seinem Laptop auf, um Befehle zu bellen oder in zwei Sätzen ein Stop-Motion-Video mit Legofiguren zusammenzufassen, das man gesehen haben müsste und durch die Zusammenfassung deutlich an Reiz verlor. Nachdem wir da also einige Minuten saßen und ich einer Gehaltserhöhung so nah war wie noch nie, fiel ihm auf, dass etwas nicht stimmte. Er hatte einen Film erwähnt, den er gesehen hatte, und er hatte ihn jetzt nicht augenblicklich vor der Nase flackern, sondern nur in der Erinnerung. Das fühlte sich ganz offensichtlich scheußlich an für ihn. Gerade noch rechtzeitig fiel seinen hektischen Fingern ein, dass er ja ein mittelmäßig onlinefähiges Handy dabei hatte, also suchte er jetzt einen Trailer zu besagtem Film, aber da dieser Trailer bei Google wider Erwarten nicht auf der Startseite auftauchte, fing das Suchen an und also war das Gespräch beendet, auch wenn es von da an noch eine endlose halbe Stunde dauerte.
Ich hätte währenddessen einen Seiltanzkurs beginnen, aus einer Schildkröte einen Hut basteln oder einfach bloß Genervtheitssuizid begehen können, nichts wäre dazu angetan gewesen, seine Aufmerksamkeit zu erregen, denn endlich konnte er noch eben den Status seines Avatars bei Second Life abfragen, Mails abrufen, kurz antworten und, wo er gerade dabei war, rasch bei einer Tickethotline anrufen und vielleicht gerade noch schnell, nur fünf Minuten, einen Urlaub buchen. Dabei war ich es doch, der sich weit weg wünschte.
Ich war von gerade zu sarrazinischer Wut erfasst. Alle Deutschen teilen schließlich ein bestimmtes Gen, das Aufregen (Da ich unter Wortspielsucht leide, hat die Aufsichtsbehörde für Sprachverunreinigung, Abteilung Limericks, Kalauer und Mario Barth, mir nach einem kurzen Briefwechsel diesen Satz abgenickt).
Nachdem ich ein Buch über Handys verfasst habe und vom israelischen Botschafter dafür beschimpft worden bin (ich hatte einige sehr PR-taugliche Sabbatscherze eingebaut), machte ich mich an eine kühle Analyse der Situation und bereitete eine WG-interne PowerPoint-Präsentation vor. Dabei stieß ich auf den amerikanischen Psychologen Barry Schwartz. Schwartz hat den Begriff Paradox of Choice entwickelt. Denn Wahlfreiheit macht nicht glücklich.
Je mehr Nachrichten uns zur Verfügung stehen, je mehr Tabs wir geöffnet haben, desto weniger können wir uns entschließen, noch irgendetwas zu lesen. Es könnte immer hinter dem nächsten Tab die noch interessantere, die noch genauer auf meine Bedürfnisse passende Information warten, mein Handy kann mir etwas verraten, was mein seltsam analoger Gesprächspartner nicht weiß. Am Ende steht der Überdruss: alles ist wichtig = nichts ist wichtig.

Schwartz möchte deswegen nicht den Stalinismus einführen und um sicher zu gehen, dass ihm das niemand unterstellt, sagt er zu Beginn seiner Vorträge, dass Freiheit etwas Großartiges sei.
Und natürlich gibt es kein Zurück zu dem Zustand, drei Fernsehkanäle und einen Festnetzanschluss zu haben. Dennoch sind die Konsequenzen des Wahlparadox interessant: Unzufriedenheit und Apathie.
Aber warum denn unzufrieden? Wenn ich über Google News mein tägliches Nachrichtenpaket beziehe, kann ich den Newsfeed ganz nach meinen Bedürfnissen zusammenstellen. Langweilt mich Wirtschaft, dann werde ich eben über Wirtschaft nicht mehr informiert und wenn ich das möchte, bekomme ich stattdessen Prominews und Sportergebnisse aus der ganzen Welt. Wenn Beschränktheit nicht zufrieden macht, was denn dann?
Und Apathie?
Als 2009 im Iran die Anhänger der Opposition auf die Straße gingen und an der Zensur vorbei twitterten, da wurden all jene Lügen gestraft, die glaubten, der Westen sei längst entpolitisiert und betrachte Ereignisse in fernen Ländern ungefähr mit dem Enthusiasmus, mit dem olympische Gehwettbewerbe von Zuschauern verfolgt werden, die keine Karten für das Schwimmturnier bekommen haben. Weit gefehlt: Das Internet überschlug sich vor Solidarität, auf Twitter färbten sich die Profilfotos der Nutzer grün, als Zeichen der Verbundenheit mit den geschundenen Iranern, die Handyfotos wurden eifrig verbreitet, fast glaubte man, die Jugend der Welt würde sich nun bewaffnen und das Mullahregime wegfegen – da starb Michael Jackson. Die Plattenindustrie hatte endlich einen Weg gefunden, ihren Tod aufzuhalten – die Künstler müssen bloß sterben. Mehr medialer Enthusiasmus war nie. Unfair, liebe Perser? – Habt Ihr vielleicht unsere Jugend versüßt mit lustigen Zombiefilmchen, Frisureneskapaden und Pädophileprozessen? Und wer seid Ihr überhaupt? Kein Pieps war mehr zu hören über den Iran.
Ich habe mich für den Iran auch nur so lange interessiert, bis ich angetrunken nach Hause kam und auf Spiegel Online stand, dass Jackson tot war. Dann habe ich geschaut, was meine Freund so dazu geschrieben hatten und guckte ein paar Videos, die sie verlinkten. Wir waren alle zusammen noch einmal acht Jahre alt und staunten über diesen großen Entertainer. Wir sind ungeheuer nostalgische Kinder. Und so ist auch unsere Aufmerksamkeitsspanne die eines Achtjährigen auf Coca Cola-Trip.
Aber macht das das Netz mit uns? Machen uns Handys hektisch oder benutzen wir nicht gerade Handys, weil wir große Hektiker sind?
Wie würde das Netz wohl ausgesehen haben, wenn die alten Griechen es erfunden hätten oder Leonardo Da Vinci?
Alle unter Vierzigjährigen sind aufgewachsen mit der Idee, alles jetzt und sofort bekommen zu können. Unser Anspruch heißt: Ich will das JETZT. Netz und Handy sind da nur zufällige Mittel zum Zweck. Beides könnte man ganz entspannt nutzen. Man müsste bloß. Oh, das Handy klingelt. Es könnte etwas Unwichtiges sein, ich muss ran.


