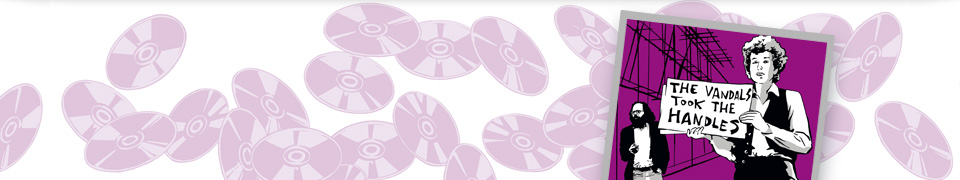Am Tag, an dem Simon & Garfunkel in New York ihr schönstes Lied aufnehmen, entsteht in Vietnam eine der verstörendsten Fotografien des 20. Jahrhunderts – und Richard Nixon bewirbt sich um das Präsidentenamt. Die Geschichte eines unpolitischen Songs.
***

Vielleicht lag eine „New York Times“ auf dem Fenstersims, als Paul Simon und Art Garfunkel am 2. Februar 1968 das Tonstudio ihres Labels Columbia in Manhattan betraten. „There’s no time at all“, heißt es immerhin in ihrem dort entstandenen Lied „Overs“, „just the ‚New York Times‘ sitting on the windowsill near the flowers.“ Das Duo war gerade mit der Arbeit an „Bookends“ beschäftigt, seinem vierten und vorletzten Album, das zwei Monate später erscheinen würde. Die Mehrheit der Songs war fertig, den schönsten hatten sie bereits am Tag zuvor aufgenommen: „America“, eine zeitraffende Kurzgeschichte über die einsame Zweisamkeit eines Liebespaars auf Reisen, das gar keine universelle Zeitdiagnose zu sein scheint und doch so heißt wie die ganze Nation mit den „einsamen Augen“. So jedenfalls hört man es auf der Albumversion von „Mrs. Robinson“, die an eben diesem 2. Februar eingespielt werden sollte.
Nehmen wir also an, Simon und Garfunkel hätten auf die Titelseite der Zeitung geblickt, bevor sie mit dem Singen begannen. Was hätten sie gesehen?
Eine bemerkenswerte Momentaufnahme amerikanischer Zeitgeschichte. Links eine Meldung: Am gestrigen Tag habe der ehemalige Vizepräsident Richard M. Nixon seine Bewerbung um die republikanische Nominierung zur Präsidentschaftswahl 1968 eingereicht. Rechts eines der berühmtesten Fotos des 20. Jahrhunderts: Aus Nahdistanz exekutiert Nguyễn Ngọc Loan, Polizeichef des mit den Vereinigten Staaten verbündeten Südvietnam, wie nebenbei den Vietcong-Kämpfer Nguyễn Văn Lém mit einem Schuss in den Kopf. Die Aufnahme aus den ersten Tagen der Tet-Offensive ließ viele Amerikaner an der Legitimität des Krieges zweifeln.
Wer „America“ hört, denkt nicht an dieses Bild, nicht an Vietnam, nicht an Nixon. Und doch führt dieser unpolitische, naive, klischeehafte, wunderschöne Song über einen Tramper, der von Michigan aus ostwärts fährt, „um Amerika zu suchen“ am Ende genau dorthin.
Let us be lovers, we’ll marry our fortunes together
I’ve got some real estate here in my bag
Die Aufforderung zum Durchbrennen, die das lyrische Ich an ein anfangs noch unbenanntes Du richtet (wohl Simon selbst, der zu seiner damaligen Freundin Kathleen Chitty spricht), ist erfüllt von einer Unbekümmertheit im Sinne von „Freedom’s just another word for nothing left to lose“. Der „real estate“ in der Tasche: ein bisschen Platz für „a pack of cigarettes and Mrs. Wagner’s pies“ und vielleicht noch drei, vier weitere Habseligkeiten. In deutscher Übersetzung wird die Ironie sogar noch deutlicher. Besagte „Immobilie“ zeichnet sich dadurch aus, dass sie gerade nicht immobil ist, sondern beweglicher Grundbesitz, der in jeden Kofferraum passt. Wer sich die Exegese sparen will, folgt Simons eigener Erklärung aus Robert Hilburns Biographie von 2018: „The ‚real estate in my bag‘ was grass.“
Die schlichte Bild- und Harmoniesprache – der Kontrast zwischen der spärlichen Wegzehrung und dem grandiosen Ziel, der bedächtige Abstieg von Dur ins parallele Moll auf dem Wort „America“ – bediente Phantasien des Ausbruchs in Simon & Garfunkels Hörerschaft, die vorrangig zur weißen Mittelschicht gehörte und deren Eltern meist entschieden mehr besaßen als mit Apfelkuchen vollgestopfte Reisetaschen. Suburbane Sehnsüchte entladen sich hier in der Metapher eines unpragmatischen Roadtrips nach Irgendwo.
So we bought a pack of cigarettes
And Mrs. Wagner’s pies
And walked off to look for America
Der Zusammenfluss von Bürgerlichkeit und Fernweh jenseits politischer Zeitlichkeit lässt sich kaum besser illustrieren als mit einer Szene aus Cameron Crowes Film „Almost Famous“ (2000). „Dieser Song erklärt, warum ich von Zuhause weggehe und Stewardess werde!“, herrscht die achtzehnjährige Anita Miller (Zooey Deschanel) darin ihre Mutter, eine starrköpfige Psychologieprofessorin (Frances McDormand), an. Im Hintergrund schwillt die einzigartige Summharmonie im Intro von „America“ an, einen Moment später steigt Anita ins Auto, dann fährt sie mit ihrem Freund in die vermeintliche Freiheit. Der solle, sagt die Mutter zum Abschied, beim Einladen den Vorgarten nicht so zertrampeln. Und murmelt noch: „She’ll be back.“
(„This song explains why I’m leaving home to become a stewardess.“)
So klingt „America“ von der anderen Seite, der von squares und verantwortungsvollen menschlichen Zahnrädchen bevölkerten Welt, über die sich das Liebespaar in der Bridge belustigt – einem für Simon typischen kompositorischen Kunstgriff. Auf die zweite Strophe folgt statt eines gewaltigen Refrains eine Art Bremsmanöver, ein zwischen zwei Septakkorden changierendes Autobahnspiel gegen die Langeweile: Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ein schlecht getarnter Spion. Wenn es in dem Lied eine Stelle gibt, die die Umstände der Ära spiegelt, dann diese. Der Kalte Krieg ist mit an Bord, aber nur aus Spaß.
Laughing on the bus
Playing games with the faces
She said the man in the gabardine suit was a spy
I said, „Be careful, his bow tie is really a camera“
Wie viele Meilen, Stunden sind vergangen, als das Spiel vorbei ist? Es ist jedenfalls Nacht geworden. Die Zigaretten sind aufgeraucht, der Mond ist aufgegangen.
„Toss me a cigarette, I think there’s one in my raincoat“
„We smoked the last one an hour ago“
So I looked at the scenery, she read her magazine
And the moon rose over an open field
Der Dichter und Literaturnobelpreisträger Derek Walcott bekannte später seine Schwäche für letztere Zeile und ihre, so Walcott, „Zen-like elegance“. Kurz vor der Jahrtausendwende schrieben er und Simon zusammen das Broadway-Musical „The Capeman“, dessen Song „Trailways Bus“ direkt auf ebenjenen Mond Bezug nimmt. Aber wenn „America“ eines nicht ist, dann ein konventionelles Gedicht. „Der Song ist einer der seltenen Popsongs, die ohne Reime auskommen“, schreibt Robert Hilburn. „Er ist reine Prosa.“
„Kathy, I’m lost“, I said
Though I knew she was sleeping
„I’m empty and aching and I don’t know why“
Counting the cars
On the New Jersey Turnpike
They’ve all come
To look for America
All come to look for America
All come to look for America
So verwaist auf dem Bildschirm, ganz ohne Musik, mutet dieses Ende fast inszeniert an, sogar larmoyant. Auf diese Theatralik muss man sich einlassen können – was mit Instrumental-Crescendo und Garfunkels Tenorharmonie anders als in gedruckter Form aber gar nicht schwerfällt. Wo läge sonst die Lizenz zum Beinahe-Kitsch, wenn nicht in Popmusiktexten und nächtlichen Busfahrten, auf denen man, den Kopf ans Fenster gelehnt, den Blick auf vorbeiziehende Autokarawanen wirft?
Sind wir am Ende? Der Song schließt mit keinem Fund, sondern dem Andauern der Suche. Dass er seine eigene Frage – woher meine, deine Traurigkeit? – nicht beantwortet, verleiht ihm die schwebende Zeitlosigkeit, die ihn berühmt machte. Kein Nixon. Kein Vietnam. Oder?
Das ist komplizierter. Sofern man den Songwriter als Biographen seiner Figuren verstehen darf, geht die Geschichte nämlich noch weiter. Mehr als vierzig Jahre nach „Bookends“ erschien auf Paul Simons Album „So Beautiful or So What“ (2011) der Song „Rewrite“. Darin geht es um einen Veteranen aus dem Vietnamkrieg, der als Autowäscher arbeitet und insgeheim davon träumt, ein erfolgreiches Theaterstück zu schreiben. Glaubt man Simon, ist es derselbe Mann, der in „America“ mit Kathy in den Bus stieg.
„Das ist eine Generationengeschichte“, sagt Simon in Hilburns Buch, „und als ich den Song [„Rewrite“] später auf Konzerten spielte, spielte ich ihn vor ‚America‘, und mir wurde klar, dass der Junge, der in Pittsburgh in den Trailways-Bus steigt, der alte Mann in der Autowäscherei ist. Der Typ ist eine Version meiner selbst, meiner Generation, derjenigen, die in Vietnam beschädigt wurden.“
Hier schließlich sieht man den Eskapismus von „America“ in den Realismus münden, den die „New York Times“ vom 2. Februar 1968 nahelegt. Nixon sollte die Wahl gewinnen und der Vietnamkrieg trotz Fotos wie dem von der Exekution Nguyễn Văn Léms noch sieben weitere Jahre andauern.
Dass „der Typ“ aus „America“ selbst nach Vietnam beordert worden sein soll – womöglich von Kommandant Nixon – muss man nicht akzeptieren. Wie es fiktionalen Figuren nach dem Ende einer Geschichte ergeht, entscheiden Hörer mindestens genauso sehr wie Schöpfer. Man kann das lyrische Ich von „America“ also weiter Autos auf dem New Jersey Turnpike zählen lassen, während aus dem Farmland still der Mond aufsteigt. Niemand nimmt einem das. Doch die Koinzidenz der Schlag- und Songzeilen erzählt eine melancholische Geschichte eigenen Rechts. Sie handelt von derselben Suche, der nach dem Land mit den einsamen Augen.
(„New York Times“ vom 2. Februar 1968)
***
Simon & Garfunkel: „America“
“Let us be lovers, we’ll marry our fortunes together
I’ve got some real estate here in my bag”
So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner’s pies
And walked off to look for America
“Kathy”, I said, as we boarded a Greyhound in Pittsburgh
“Michigan seems like a dream to me now
It took me four days to hitch-hike from Saginaw
I’ve come to look for America”
Laughing on the bus
Playing games with the faces
She said the man in the gabardine suit was a spy
I said, “Be careful, his bow tie is really a camera”
“Toss me a cigarette, I think there’s one in my raincoat”
“We smoked the last one an hour ago”
So I looked at the scenery, she read her magazine
And the moon rose over an open field
“Kathy, I’m lost,” I said, though I knew she was sleeping.
“I’m empty and aching and I don’t know why”
Counting the cars on the New Jersey Turnpike
They’ve all come to look for America
All come to look for America
All come to look for America