Manchmal stolpere ich im Internet über Sätze, angesichts derer es mich fast ein bisschen ärgert, dass nicht ich sie geschrieben habe. Ich hätte sie im Prinzip so ähnlich schreiben können, wenn ich mich hingesetzt hätte und über die Thematik nachgedacht hätte, aber dann muss ich erkennen: Ein anderer war eben schneller und dazu noch gut auf den Punkt. Und in diesem Fall kommt noch verschärfend hinzu, dass der Urheber ein Netz-Theoretiker ist, mit dessen Thesen ich sonst nicht unbedingt konform gehe.
Ich entdecke in mir eine ansteigende Müdigkeit für die ganzen Debatten zum Internet, digitalen Zeitalter, Web, Facebook und Bla. Ich glaube, der Netz-intellektuelle Diskurs verliert massiv an Relevanz, gerät zu einer zumindest temporären Sackgasse. Ich bekomme den Eindruck, das Wesentliche ist für den Moment gesagt und gedacht; der Diskurs-Acker hinreichend bestellt, der Bedarf an Thesen erstmal gesättigt. Alles, was ich zu diesen Themen lese, zur Dynamik der Sozialen Netzwerke, zur Krise des Geistigen Eigentums, zu Datenschutz und Kontrollverlust, zur Filter-Bubble und Ambient Intimacy, zu Überwachung und Transparenz, zum Offenen Web und Geschlossenen Gärten, kommt mir vor wie schon tausendmal gehört, und alles, was ich selbst dazu schreibe, wie schon tausendmal gesagt, und alles, was ich beantworte, wie schon tausendmal gleichermaßen widerlegt und bestätigt.
So schreibt Christian Heller, der Autor des hier kürzlich besprochenen Post-Privacy-Buches, dieser Tage auf seiner wikiartigen Webpräsenz plomlompom.de – und ich ertappe mich bei heftigem Kopfnicken. Abgesehen davon, dass mir das Stichwort Ambient Intimacy nicht viel sagt und ich hier in diesem Blog das Thema geistiges Eigentum nicht beackert habe (das hat die Kollegin Sophia Infinitesimalia dankenswerterweise erledigt), könnte ich diesen Absatz auch fast 1:1 als Jahresbilanz meiner Mitarbeit bei „Deus ex Machina” übernehmen. Nun gut, die Filter-Bubble hatte ich hier nicht thematisiert, dafür aber die sogenannten Facebook-Revolutionen im nahen Osten, Datenliebe, Cloud-Computing, Wikileaks und diverse andere Themen, die talk of the town im Netz gewesen sind.
Das soll nicht heißen, dass damit der ganze Horizont der Möglichkeiten abgeschritten wäre und die kommenden Jahre keine spannenden Themen mehr versprächen. Aber irgendwie bleibt das Gefühl zurück, dass sich der Netzdiskurs irgendwie im Kreis dreht, dass große visionäre Würfe (seien sie nun utopischer oder dystopischer Natur) mit Bezug auf das Internet kaum noch zu erwarten sind. Sascha Lobo ist kürzlich der Frage nachgegangen, ob das Netz politisch rechts oder links tickt. Im Prinzip weder noch, vielmehr sei im Netz viel von der „kalifornischen Ideologie” eingewebt, die vernetzte Technologie als grundsätzlich gut begreift, weil sie der umfassenden Selbstermächtigung des Einzelnen diene – und das unerachtet der ungeheuren Abhängigkeit dieser Struktur von Politik, Infrastruktur und Energie. Im Kern gehe die Internetideologie davon aus, dass jedes soziale Problem eine technische Lösung hat. Oder anders ausgedrückt beruht die kalifornische Ideologie auf dem Glauben, dass der technologische Fortschritt liberale Prinzipien unweigerlich zu einer gesellschaftlichen Tatsache machen werde.
Freilich kann Netzideologie außer der speziell kalifornischen Verbindung von Hippie-Denke und Halbleiter-Lötzinn noch eine ganze Reihe anderer Ingredienzen in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen enthalten. Zu nennen wäre hier Brechts Radiotheorie mit der Forderung des Dramatikers, den Rundfunk vom Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln – und damit jedem Empfänger die Möglichkeit zu geben, auch Sender zu sein. Dazu nehme man Marshal McLuhans Metapher vom globalen Dorf, das Cluetrain-Manifest („Märkte sind Gespräche”) oder auch die hochtrabende Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace, in der es anno 1996 hieß: „Regierungen der industriellen Welt, Ihr müden Giganten aus Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, der neuen Heimat des Geistes. (…) Wo wir uns versammeln, habt Ihr keine Macht.”
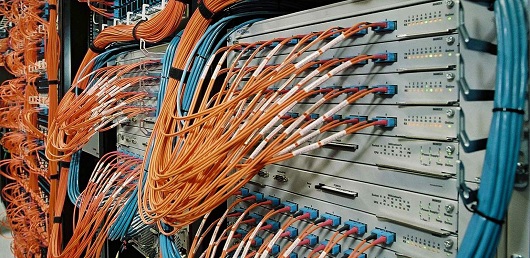
Aber genau das hat sich in der Zwischenzeit als Wunschdenken entpuppt. Die Macht der Regierungen und Konzerne ist nicht zerbröselt. Angesichts der neu entstandenen gigantischen Datenkraken wie Google und Facebook sowie der immer weiter reichenden staatlichen Überwachungsmaßnahmen stellt sich die Machtfrage vielmehr nachdringlicher denn je. Zumal die Geschichte der sogenannten Facebook- und Twitter-Revolutionen auch keine überwältigende Erfolgsbilanz aufweist. Kurz gesagt: Das Netz mag emanzipatives Potenzial haben, aber es wirkt per se nicht unbedingt und überall als Katalysator für gesellschaftlichen Fortschritt und den Abbau von Hierarchien. Bei aller Begeisterung über die bunte Welt und die Mitteilungsmöglichkeiten bei Facebook, Twitter & Co. ist die Vision einer Gesellschaft ohne nennenswerte Privatsphäre für die Mehrheit immer noch ein Schreckensszenario. Und Denkansätze wie die Plattformneutralität, die der Blogger Michael Seemann vor einiger Zeit im Dienste dieser Zeitung ausarbeitete, sind so abstrakt und erklärungsbedürftig, dass sie die Massen nicht unbedingt in gesellschaftsverändernde Aufbruchsstimmung versetzen. Selbst die Piratenpartei, die Netzpolitk gewissermaßen in ihrem Genom verankert hat, muss erkennen, dass große gesellschaftliche Würfe nicht unbedingt mit dem Hebel HTML zu stemmen sind. Und egal, wie man im Einzelnen zu der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) stehen mag, es ist ein mutiger Schritt in die richtige Richtung – nämlich heraus der Nerd- und Netznische.
So ist es nur folgerichtig, dass sich zu den ganzen Dampfplauderern der Daseins-Digitalität und Erweckungspredigern des elektronischen Zeitalters neuerdings ein anderer Typus des Netzdenkers gesellt – der Skeptiker, wie ihn zum Beispiel der Weißrusse Ewgeny Mozorov verkörpert. Sein Artikel „Das Elend der lnternetintellektuellen” ist mehr als nur eine Abrechnung mit dem Vorzeige-Netzdenker Jeff Jarvis und dessen neuestem Werk „Public Parts”. Es geht ihm prototypisch um das ganze Genre der von der kalifornischen Ideologie durchdrungenen Netz-Topcheckern, ob sie nun Jarvis, Shirky, Scoble oder Godin heißen. Morozovs Urteil: „Der Mangel an elementarer intellektueller Neugier ist das Wesensmerkmal des Internetintellektuellen. Die Geschichte besteht nun einmal aus kleinen Dingen, doch kein Internetintellektueller möchte klein denken. Sie denken lieber groß – nachlässig, ignorant, hochtrabend und ohne den geringsten Sinn für den Unterschied zwischen kritischem Denken und Marktpropaganda.”

Was folgt nun aus alledem? Wir werden uns auf der Suche nach neuem und inspirierendem Input zwangsläufig woanders umsehen müssen, uns aus der Komfortzone der Retweets, Trackbacks, Netzkongresse und der selbstreferenziellen Medienzirkel auch mal hinauswagen. Zum Beispiel in Richtung Naturwissenschaften und Geschichte, Welt-Erfahrung und Meditation, Kunst und Spiel, wie Christian Heller vorschlägt. Denn, so sein Zwischenfazit nach anderthalb Jahrzehnten Netz-Erkundung: „Wie furchtbar eng und staubig kommt mir da inzwischen eine Rollen-Definition als ‚Netz-Intellektueller‘ vor.” Tja…



