Am leuchtenden Sommermorgen
Geh ich im Garten herum.
Es flüstern und sprechen die Blumen,
Ich aber, ich wandle stumm.
Heinrich Heine
Die Gegend ist reich. Es ist Sommer. Da kann natürlich auch ein Cabrio in Goldorange gleissend herumstehen. Hinter einem Hügelchen aus Sand und Kies. Neben einem Garten, direkt am Bach, also in der Ideallage innerhalb der Anlage. Es ist Sommer, da steht ein offenes Auto, da wird etwas gemacht, da arbeitet jemand. Oder lässt arbeiten. Zum Beispiel an einer Erweiterung des kleinen Hauses, das im Garten steht. Soweit ist alles scheinbar normal. Oder wäre es, wenn es sich dabei nicht um einen Schrebergarten handeln würde.

Diese Anlage hier bestand schon zu einer Zeit, als die reichen Familien der dummen, kleinen Stadt an der Donau noch in ihren alten, bröckelnden Stadthäusern Hof hielten. Damals war das etwas für die Armen in der überfüllten Stadt, die sich zu 20 oder mehr in den Speichern der Barockhäuser drängten, und kein eigenes Land hatten. Die Reichen besassen Grundstücke draussen bei der Schiessanlage, wo sie am Wochenende ihrer Leidenschaft für Waffen nachgingen. Die Herren schossen, die Damen kümmerten sich um Gärten. Später dann, als Schiessen nicht mehr modisch war, zogen die reichen Familien hinaus in die Gärten, wo sie neue Häuser bauten: So entstand hier das Westviertel der reichen Leute. Die pittoresken Schrebergärten sind etwas nördlich davon, und wurden meistens von normalen Menschen betrieben. Früher eben von den Einheimischen, die in der Stadt wohnten. Sie nannten sich Moosgmoa, die Moosgemeinde.
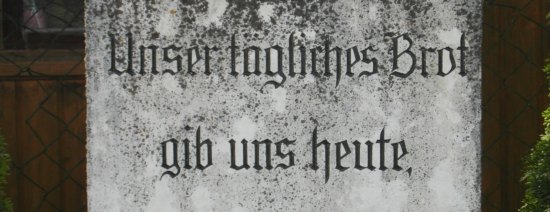
Später dann, als die Einheimischen in andere Vorstädte und eigene Häuser mit Gärten zogen, zogen hier die Migranten nach, die in ihren anatolischen und calabresischen Dörfern arme Tagelöhner und Bauern waren, und trotz der Arbeit in der grossen Firma das Pflanzen und Ernten nicht aufgeben wollten. Der Mensch kann nicht aus seiner Haut, er mag vielleicht Schlösser oder Bandarbeiter genannt werden, aber zu nah ist noch die Erinnerung an die Erde, den Geruch von Leben und den langsamen Wandel des Jahres, den man in der immer gleich warmen, gleich beleuchteten Firma vermisst. Also mieteten sie von den alten Besitzern oder den Vereinen die Schrebergärten. So einen Garten kann man nur noch an die Türken vermieten, hiess es früher. Aber das sagte man auch über die bröckelnden Barockbauten der Innenstadt.

8 Millionen, so ein Gerücht, hat gerade ein Notar für so ein altes Geschlechterhaus in Bestlage bezahlt. Unrestauriert. Am Ende kostet es dann vielleicht 12 Millionen, und der Notar wird bis an sein Lebensende keine Steuern mehr zahlen. Man investiert 12 Millionen nicht für Zuwanderer, es sei denn, es ist das Management der grossen Firma. Längst gibt es hier in der Altstadt keine armen Menschen mehr, die Handwerkerviertel sind heute schöner, als sie je gewesen sind, und wo die Brauerei stand, entwickeln sie gerade Luxuslofts in Citylage. Rechtlich darf man Dachterrassen beim Vermieten nur mit der Hälfte der ihrer Quadratmeterzahl einberechnen. Aber in der Realität macht die Dachterrasse den grossen Unterschied zwischen denen, die alles in der Stadt haben und auch bezahlen können, und jenen, die zwar in der richtigen, angesagten Gegend wohnen, aber nicht alles haben. Denn die Bewohner der Vorstädte, mit langen Anfahrtswegen und toten Käffern geschlagen, in denen es nicht mal mehr einen Bäcker gibt, sagen den Stadtmenschen im fadenscheinigen Triumph: Also, die Stadt ist schon schön aber ohne Garten im Sommer, das ist schlimm. Und wenn dann erst Kinder kommen! Wollt ihr die in der Wohnung halten? Und sie nur im Urlaub an die frische Luft lassen?

Billig ist so ein Sieg, und genervt blättern die Unterlegenen hier dann in den diversen Einrichtungszeitschriften und Landmagazinen, die gerade das schöne Leben im Freien preisen. Und dann hört man über Ecken, dass die Anwältin A., die für den P. die Verträge macht, jetzt so einen Schrebergarten gemietet hat. Und ganz hübsch herrichtet. Also nicht wie früher, wo es nur Gemüsebeete gab, sondern wie eine kleine Villenanlage: Gras, Buchsbäume, Oleander, und in der Laube, die ein bis auf den letzten Millimeter der zulässigen 24 m² ausgebautes Steinhaus ist, hängt ein Kronleuchter. Das geht schon fast in Richtung Landhaus. Bis zu 30 Leute kann sie dort einladen. Und dort kann man auch grillen, ohne dass sich jemand belästigt fühlt. Es gibt auch einen offenen Kamin. Eine Spielecke für Kinder. Und 300 Quadratmeter Grund ist mehr, viel mehr, als pro Toskanaluxusbunker in der Vorstadt für vier Rekordpreise zahlende Familien an Gartenanteil übrig bleibt.

Es ist Sommer, die Sonne scheint, in der Mitte der Anlage ist ein Biergarten, den kann man mal besuchen, die machen da auch Radifeste, und man hat auch die Wegbeschreibung zum Garten der A. dabei. Da sind natürlich immer noch die kleinen Gärten für den Gemüseanbau, aber auch hohe Hecken, hinter denen sich durchaus nicht ganz kleine Häuser abzeichnen. Das, so erfährt man, war nach dem Krieg nämlich so, dass Wohnungsnot war, und damals wurde es geduldet, wenn sich Familien hier noch den ein oder anderen Raum anbauten. Es gibt hier also Gärten mit Gemüse und Gärten mit Steinlöwen, es gibt Hütten und Häuser, es gibt Zäune und hohe Hecken, es gibt Stacheldraht und Alarmanlagen, es gibt Pumpen und Wasser-, Strom-, Heizung- und Internetanschluss. Es ist auch hier nur scheinbar alles gleich. Manche sind gleich und andere sind gleicher. Und für vergleichsweise kleines Geld, in Relation zu den Gartenanteilen der Vorstadt, kann man so etwas auch mieten. Dann hat man die Wohnung in der Stadt und den Garten auf dem Land. Wie schon vor 100 Jahren einmal. Und die Besitzer freuen sich sicher, anständige Mieter zu haben, die mehr zahlen, als die Migranten zahlen können. Und so steht eines Tages dann ein Cabrio in der Anlage, es wird gemörtelt und angebaut und bald auch das Housewarming gefeiert. Alle sollen es wissen, die Freunde in der Stadt und die dumme Dorfschnepfe. Die ganz besonders.

Und wie es nun mal so ist: Mit dem neuen Raum kommen auch neue Ideen. Die Unterbringung von Gästen, in der Stadt meistens ein Problem; hier ist Abhilfe geschaffen, wenn die Laube nur luxuriös genug ist. Die geschweifte Kommode, die keinen Platz mehr fand: Hier darf sie verweilen. Und wenn die Hecke erst mal hoch genug ist, kann man hier vielleicht auch das Cabrio unter einem nicht ganz legalen, aber praktischen Vordach einstellen, wenn es Winter wird. Die Bank ruft an und fragt, ob man nicht für ein paar zehntausend Euro in nachwachsende Rohstoffanlagen investieren möchte; vielleicht sollte man statt dessen den Garten nicht gleich kaufen? Den Freunden in der Stadt kann man sagen, dass es dort im Sommer zu heiss ist; man zieht lieber ab und zu ein wenig raus: Das ist Prestigegewinn. Bleibt noch das Übel, dass es immer noch ein Schrebergarten in der Moosgemeinde ist: Da muss ein Rebranding her. Aber in einer Stadt, wo aus der Altstadt die City-Bestlage und aus dem Fischerstüberl am Baggersee das Haus am See mit Loungecharakter wurde, sollte sich auch das machen lassen.

Es geht natürlich nicht jeder Garten in jeder Lage, aber die besseren Gärten in dieser Lage, die gehen absolut, für den Sommer, für die Freizeit, für das ungespritzte Gemüse und die eigenen Tomaten, für den grösseren Einkauf bei den Blumenständen am Wochenmarkt und beim Gefühl, später einmal Kindern zeigen zu können, wie man Leben schenkt und erhält: Mit dem richtigen Eigentum in der richtigen Lage. Wo die richtigen Leute sind, und die anderen sind halt woanders. Das war auch schon vor 100 Jahren nicht anders, nur waren damals die Gärten und Häuser grösser, und es hätte keiner darüber seine Scherze gemacht: Damals nahm man den Stand noch ernst, und man hatte Schusswaffen.



