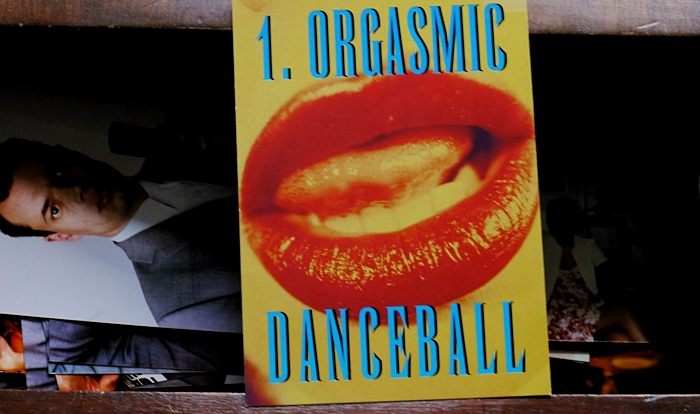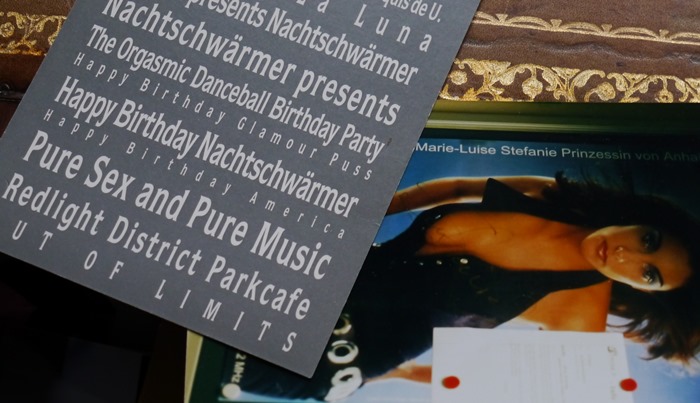Nothing matters
Ambrose Bierce
Sie sind jung, sehen schön und gepflegt aus, studieren, und können sich durchaus eloquent ausdrücken. Sie haben keinerlei Ähnlichkeit mit den wenigen Vertreterinnen des RCDS, die ich in meiner Jugend kennenlernte, und die wie ein mitteljung gebliebener Landfrauenbund aussahen. Ich mein, ich bin hier geboren, aber es gibt so Ecken in Niederbayern und der Oberpfalz, da brauche auch ich fast einen Übersetzer, und von dieser Natur waren sie. Die RCDS-Damen jedenfalls haben wir damals mit dem Kompliment hofiert, sie würden ganz vorzüglich zu ihren männlichen Kollegen passen, und hintenrum diskutierten wir den begrenzten Genpool hinter Landshut. Die jungen, schönen Studentinnen, denen ich aus Gründen der Recherche bei Twitter folge, sind allerdings nicht beim RCDS. Sie sind Anhängerinnen der AfD. Ich sitze an meinem Rechner, und sie schreiben, dass sie nun den Stream des EFN-Kongresses anschauen. Ich bin wirklich hart im Nehmen und wundere mich über gar nichts mehr, aber in diesem Moment schweift mein Blick vom Rechner hinüber zu den Photos meiner Jugend, und ich denke mir: Mädchen. Du bist jung. Du bist erkennbar klug. Warum geniesst du nicht einfach das Leben? Du hast alle Freiheiten, du musst deine Jugend nicht damit vergeuden, Typen wie Salvini und Wilders anzuschauen.
Denn es ist die grosse Zeit des Lebens. Es ist die Zeit der Experimente, der Freiheit und der Unbekümmertheit, und man kann Dinge tun, die man mit 40, 50 allenfalls noch tut, wenn man es sich als schlechterer Sohn aus besserem Hause noch leisten kann. Es ist die Zeit der engen Pailettenkostüme und der Benutzung aller körperlichen Reize. Nie wieder wird man so unbekümmert auf Menschen zugehen und sie verführen, wie mit 20 Jahren. Jede Sekunde mit Salvini ist verloren, jede Sekunde mit den Freuden des Studentenlebens ist etwas, das einem an kalten Wintertagen auch Jahrzehnte später ein Lächeln aufs Gesicht zaubert.
Ich war auch so. Ich war Student und in einer grossen Stadt, und plötzlich im Zentrum des Geschehens. Die Welt lag einem zu Füssen. Nicht am Anfang des Semesters, aber im Januar. Im überraschend warmen Januar des Jahres 1989 in München, als die Studenten aufstanden und für ihre Rechte kämpften. Ausgerechnet in München, einer saturierten Stadt, die monatelang tatenlos zugeschaut hatte, wie an anderen Universitäten der Aufstand geprobt wurde. Es gab eine gewisse Grundunzufriedenheit mit Themen wie Zwischenprüfungen, Regelstudienzeiten, Bibliotheksbenutzung, Kopierabgabe und schlechter Kommunikation. In den Gängen der Staatsoper waren wir uns einig, dass die Universitäten zu voll sind, und mehr Geld brauchten. Ausserdem begann damals die Regierung Kohl, unsere Orchideenfächer gegenüber Studiengängen mit echter Bedeutung für den Arbeitsmarkt zu benachteiligen. Sogar die TU, so eine Art Sammellager für Oberpfälzer vor der Stadt, sollte aufgewertet werden.
Kein Wunder also, dass wir etwas übernächtigt – wir waren nach dem Barbier noch im Parkcafe – auf der Strasse standen. In meiner Erinnerung war es bei der grössten Studentendemonstration, die München je erlebt hatte, warm und sonnig. Vermutlich waren wir einfach zu müde, um die Kälte zu fühlen. Die Parolen – Kohl und Möllemann, wie sind jetzt mit dem Zaster dran – haben wir natürlich brav mitgerufen, wenngleich uns “Geld und Knete für lebenslange Fete” besser gefallen hätte. Die RCDS-Vertreter fanden das überhaupt nicht gut, aber so war das eben. Wild, aufgeladen, exzessiv, hedonistisch. Und ich war qua Studiengang auch noch in dem Fachbereich, der die anderen Studenten in den Kampf mitriss. Das passierte einfach. Die Kommunikationswissenschaftler machten Namensschilder und die Kunstgeschichtler malten Plakate, und alle zusammen fühlten sich viel zu jung, zu schön und zu modern, als dass man sich vom eigens angereistem Schnauzbartträger – der sieht ja aus wie von der TU – und Bildungsminister Möllemann etwas sagen lassen wollte.
Wenn ich mich richtig erinnere, war Möllemanns Auftritt im Audimax der LMU München der Punkt, an dem wir uns sagten: Jetzt schauen wir mal. Wir streiken. Wir fordern die Umbenennung der Hochschule in Geschwister-Scholl-Universität. Wir wollen mitreden. Mitreden am Tag und feiern in der Nacht. Audimax, Fachbereich, Milchbar, Parkcafe, Nachtcafe.
Der grosse Münchner Unistreik von 89 passierte einfach, ähnlich wie manche Umwälzung in Osteuropa. Es war damals nichts vorbereitet, an meinem Institut gab es noch nicht mal eine Fachschaft. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr – meine Freunde aus meinem Institut beschlossen, die Mensa aufzusuchen, und ließen mich am Fachbereich als Notbesatzung zurück, um zu berichten, was passiert. In diesem Moment erschienen die AStA-Vertreter und fragten, ob es überhaupt Fachschaften gäbe – für einen Streik bräuchte man sie nämlich als Ansprechpartner. Es gab sie nicht. In dem Fall bräuchten sie zumindest zur Verbindung einen Streikrat, sagten sie. Ich war der einzige aus meinem Institut, der nicht gerade in der Mensa war, und so wurde ich der Streikrat.
So ist das eben, wenn man jung ist und die Revolution kommt. Da fragt man nicht lange, da macht man einfach. Wir streikten, wie demonstrierten, und am Abend sassen wir mit dem akademischen Mittelbau und manchen Professoren, die sich an ihre eigene Jugend erinnert fühlten, zusammen, und überlegten, was wir vom Staat haben wollten. Wir lernten Studentinnen aus anderen Fächern und ihre Pailettenkleider kennen. Es waren die wilden, lebensfrohen 80er Jahre. Und in den Zeitungen stand, dass nun die Jugend auch in München aufsteht, und deshalb sei 89 das neue 68.
Was die Medien nicht sehen konnten: Es gab vom ersten Tag an massive Konflikte zwischen den Studenten und denen, die sie vertreten sollten. Der AStA in Bayern ist reichlich machtlos und nicht verfasst wie in nördlichen Bundesländern. Deshalb hatten seine Vertreter die Hoffnung, nun mit einem langen Streik die Regierung zu zwingen, ihn deutlich aufzuwerten. Der AStA wollte als Fernziel die Weltrevolution, ärmere Studenten dagegen keine Kopierabgabe. Der AStA sah den Streik als Kampf gegen Faschismus, Unterdrückung und Patriarchat, die meisten Studenten dagegen wollten studieren, feiern und ihre Freiheiten behalten. Als Streikrat hatte ich eine Delegation im Schlepptau, als wir den heissen Geräten Kommiliton_Innen der KoWis einen Besuch abstatteten.
In den Instituten wurde aber schnell klar, dass es eine übergreifende Lösung für alle nicht geben kann. Die Unis brauchten mehr Geld, aber jedes Institut hatte eigene und spezifische Probleme. Es war sinnlos, monatelang für die Durchsetzung eines mächtigeren AStA zu kämpfen, der dann zentralistisch zu befinden gedachte, was für ihn selbst der beste Weg ist. Der AStA wollte bis zur letzten Patrone kämpfen. Die Studenten bei uns mussten Referate halten – Hörsaalbesetzungen und kommunistische Agitation hätte sie schlichtweg das ganze Semester gekostet. Die Gefahr war real, denn die AStAe aus Berlin, deren Proteste niemand ernst nahm, sahen ihre Gelegenheit, in München mitzumischen. Sie versuchten eine feindliche Übernahme. Und schickten uns Daniel.
Daniel war klein, zerknautscht, ungefähr 40 Jahre alt und Berufs-Studentenvertreter im zigsten Semester. Neben die heissen Geräte der KoWis Kampfgenoss_Innen passte er optisch deutlich schlechter als zu den RCDS-Damen. Aber unter der leicht, naja, schlampigen Fassade war Daniel knallharter Kommunist. Er wurde vom AStA eingeführt und teilte Fachschaften und Streikräten mit, was man von uns in Berlin erwartete. Mehr Härte, mehr Klassenbewusstsein, mehr Aktionen, keine Kooperation mit Professoren, sondern nicht weniger als die Übernahme der Institute und der Uni. Daniel war gestählt im Berliner Kampf und hatte wenig Sensibilität für die Belange von Münchnern. Daniel hatte weder Interesse an der Staatsoper noch an der Orgasmic Party im Parkcafe, das damals wirklich von jungen Frauen frequentiert wurde, die sich für finanzielle Zuwendungen Porschefahrern hingaben und so ihr Studium finanzierten. Daniel wäre dort an der Tür gescheitert. Ich habe nie verstanden, wieso Leute, die nicht einmal ins Parkcafe dürfen, der Ansicht sind, mir von ihrem subalternen Klassenstandpunkt aus etwas auftragen zu können. Das hier war München. Hier studierte man Kunstgeschichte, um bei einem Auktionshaus oder Museum zu arbeiten und nicht, um Che-Guevara-Siebdrucke herzustellen.
Ausserdem knickte die Politik und die Unileitung bei den wirklich wichtigen Punkten ganz schnell ein und kam den Studenten, aber nicht dem AStA und Daniel entgegen: Mehr Geld, mehr unbürokratische Mitsprache bei runden Tischen, man freue sich ja, dass die Studenten nunmehr aktiv gestalten und Verantwortung übernehmen wollten – es dauerte nur zwei Wochen, und die grosse Mehrheit der Studenten war zufrieden. Es war eine grossartige Zeit. Man hatte viel erlebt und kaum geschlafen, und es der Politik so richtig gegeben. Wir waren so jung, so mutig, so hemmungslos und unerfahren. Aber wir hatten gekämpft und viel erreicht. Für uns genug, für Daniel zu wenig.
Daniel traf ich dann später noch einmal zufällig am Bahnhof. Für eine Weile hielt er sich noch in München auf und versuchte, für den AStA zu retten, was noch zu retten war. Für uns Streikräte, die wir in eine reguläre Fachschaft übergegangen waren, hatte er wenig übrig. Ich grüsste ihn, er nahm aber kaum Notiz von mir, wühlte in seiner Süddeutschen Zeitung und war empört, dass sein Exemplar kein Süddeutsche Magazin enthielt, für das er das Blatt eigentlich gekauft hatte. Das war bisher meine letzte Erinnerung an einen Aufstand, der jung, selbstbewusst und schön war, aber keine Revolution: Ein kleiner, dicker, mässig gekleideter, schlecht gelaunter Mensch am Bahnhof inmitten des Gedränges auf dem Weg nach Berlin, ihm zu Füssen eine zerfledderte Zeitung. Allerdings habe ich gestern bei der Recherche einen Beitrag eines Daniel gefunden, den er nach seiner Zeit bei uns in Berlin verfasste – vieles stimmt mit meiner Erinnerung überein, und ich denke, das ist der Mann, der mich in meiner Funktion als Streikrat an seine revolutionäre Front brüllen wollte. Genau das war seine Einstellung und seine Haltung:
Es hat sich einmal mehr gezeigt, daß in dem stickig klerikal-konservativen Millionendorf München Selbstbestimmung und Freiheit nicht ertragen werden kann. Die autonome Organisation eines StudentInnen-Treffpunkts oder alternative Seminarangebote sind dort unmöglich. Im spießigen Klein-Klein wurde die Streikbewegung zu dem, was sie hier sein soll: Ein illusionäres Strohfeuer und ein vergeblicher Ausbruchsversuch, bestenfalls ein Ventil für jeglichen Widerspruch.
Er hat keine Ahnung, wie das damals wirklich war. Für uns waren das zwei erfolgreiche Wochen Exzess, Party und völlig unverhoffter Sieg. So ist das, wenn man jung und unbekümmert ist, und ich verstehe eigentlich nicht, wie eine junge, kluge Studentin den Stream der AfD anschauen kann – lauter komische Leute in komischen Anzügen. Das ist nicht das Leben. Das Leben ist da draußen, es ist Kampf und Liebe, Freude und Sieg und man muss es nur wollen, dann schlottern die Mächtigen im Staub vor einem, denn nichts ist so stark wie die Jugend, deren Zeit gekommen ist.
Dachte ich, als ich las, womit sie ihre Zeit verbringt.
Aber:
Wir leben nicht mehr in den 80er Jahren, sondern 2017. Auch 2017 gibt es Studentenunruhen. Sie besetzen wegen der Entlassung von Andrej Holm ein Institut. Sie richten sofort ein Awarenessteam gegen Übergriffe unter sich ein, was vermutlich eine Art Sex-Stasi und eine Absage an sexuelles Vergnügen sein soll, das bei uns, ganz offen gesagt, ein Grund für die famose Vernetzung war, aber nicht nur in der Oberpfalz will man den Genpool klein halten. Sie sehen aus wie der RCDS nach dem Atomkrieg im Bunker, und zwar der RCDS von der TU. Sie sind nicht statthaft gekleidet, und sie machen Marx-Seminare. Marx. Kapital-Lesekreis. Im 21. Jahrhundert. Stalins Ableben hat sich wohl noch nicht herumgesprochen. Sie wollen Hausbesetzungen und laden Initiativen ein, die jeden Menschen mit Besitz und elitärer Denkweise abschrecken. Sie zeigen Filme, die ihre Haltung stärken, und keine Operninszenierungen. Sie schreiben über Polizisten und tragen dann das Gendersternchen für Polizist*innen nach. Sie finden die Stasi verzeihbar und falsche Angaben bei der Einstellung in Ordnung. Sie essen wie die AfD in Koblenz aus Blecheimern. Und finden das beide auch noch gut. Sie reden über “Linke Politik und Rechter Populismus”, statt über das Desiderat, wie man sexuell attraktiv wirken kann. Sie übersetzen ihre dogmatischen Presseinformationen in andere Sprachen, in denen sie auch niemand liest. Unser Daniel von damals wäre sicher begeistert, er wäre da auch im Durchschnitt nicht mehr optisch entreichernd. Und andere schauen sich den AfD-Stream an.
Die fetten Jahre für Studenten sind offensichtlich vorbei, denke ich mir, als ich den Schubladen mit den Bildern derer schliesse, die heute längst Professoren sind, Agenturen leiten oder mit einem Orchideenfach auf jenen profitablen Stellen im Medienbetrieb gelandet sind, die andere niemals erreichen werden. Der Daniel und die Petry geben jetzt den Takt der gesellschaftlichen Debatte vor, unsere Redlight District Orgien wollen beide nicht. Gedankenfreiheit und ein Leben im Luxus können sie uns nehmen, aber die Ehre, gute Zeiten mit Lea, Ann-Katrin und Paula gehabt zu haben, nicht.