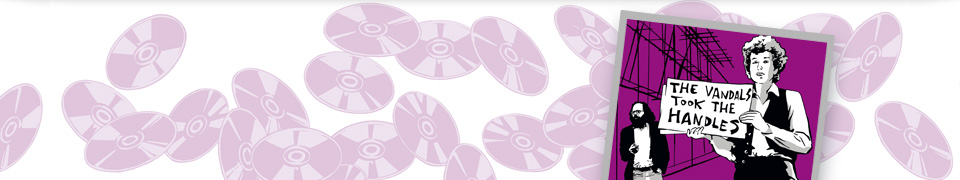Der Sänger der Sleaford Mods steht auf der Bühne permanent unter Strom. In dem Song „Jobseeker“ verarbeitet Jason Williamson seine eigenen Erfahrungen mit der Arbeitssuche. Heraus kommt ein kollektiver Wutanfall.

„So Mr. Williamson, what have you done in order to find gainful employment/Since your last signing on date?„
(„So, Herr Williamson, was haben sie denn seit ihrem letzten Termin unternommen, um eine Erwerbstätigkeit zu finden?“)
Ein Satz, der die Geschichte Großbritanniens seit 1979 in sich kondensiert. Ein Satz, der die Realität gewordene neoliberale New-Labour-Dystopie besser charakterisiert, als eine soziologische Abhandlung.
Man sieht sofort das muffige Büro mit dem eingestaubten Gummibaum im Job-Center vor sich. Man sieht den verhärmten Job-Center-Angestellten durch seine Brille blinzeln. Und man sieht den Sleaford-Mods-Frontmann Jason Williamson wie er mit genervtem Gesichtsausdruck ungeduldig auf dem Besucherstuhl herumlümmelt.
Jason Williamson wirkt immer, als sei er statisch geladen. Mit Wut. Wut über den Niedergang Großbritanniens. Wut über den Niedergang der Arbeiterklasse. „Dem Land geht es immer schlechter, Menschen sterben auf der Straße“, schimpft Williamson in einem Interview (mit laut.de). „Die Sozialleistungen werden nach wie vor gekürzt. Ständig gibt es Umstrukturierungen, die keinem helfen, es ist der Wahnsinn.“ Der herrschenden Klasse seien die Leute doch scheißegal.
Geboren wurde er 1970 in Grantham in Nordengland, auch der Geburtsort von Margret Thatcher. Später zog er in das nicht weit entfernte Nottingham. Dort lebt er heute noch. Nottingham sei ein Dreckskaff, aber eben auch seine Heimat. Auch dem Dialekt seiner Heimat ist er treu geblieben. Obwohl der in England extrem unbeliebt ist.
Williamson hat einen langen Weg hinter sich. Zwischen seinem zwanzigsten und dreißigsten Lebensjahr versuchte er Popstar zu werden. Er ging nach London. Er ging sogar nach San Francisco. Er machte Folk, er spielte Britpop, es funktionierte nicht. Geschlagen kehrte er nach Nottingham zurück. Da die Kunst kein Geld abwarf, schlug er sich mit kleinen, dreckigen Jobs durch. „Damals habe ich zwei Tage hier, drei Tage da gearbeitet und hatte am Ende der Woche 70 oder 80 Piepen die Woche“, erzählt er (in einem Interview mit Varsity). Er baute auf einem Schrottplatz Automotoren auseinander und löste das Kupfer heraus. Und er arbeitete auf einer Hühnerfarm. Dann war er Mitte Dreißig – verarmt, frustriert und gescheitert. Da traf er auf den DJ Simon Parfrement. Er schimpfte sich zu dessen Beats den Frust von der Seele und fand endlich seine Stimme. Mit Parfrement nahm er fünf Alben auf. Mit wachsendem Erfolg. 2012 trennte er sich von Parfrement. Und Andrew Fearn, mit dem er sich jetzt zusammen tat, war mehr als ein Ersatz. Mit ihm ging es erst richtig los.
Zunächst hieß die Band „That’s shit, try harder!“ Wurde dann aber umbenannt in „Sleaford Mods“. Auf den ersten Blick ist der Anknüpfungspunkt an die Anzug tragenden und Lambretta fahrenden Mods der Sechziger Jahre nicht ganz nachvollziehbar. Williamson und Fearn wirken eher wie zwei Langzeitarbeitslose. Aber die Mods waren eine Jugendkultur der Arbeiterklasse. Working Class Dandys. Williamson identifizierte sich mit der Wut und der Verzweiflung, mit der die Mods in den Sechzigern und Siebzigern das britische Establishment bekämpften. Und auch dem Motto des Mod-Gurus Pete Meaden fühlte er sich verpflichtet: „Clean Living Under Difficult Circumstances”. Nicht modisch, eher moralisch: sauber bleiben in harten Zeiten.
„Die Arbeiterklasse in Großbritannien ist unsichtbar geworden“, meint die Soziologin Lisa McKenzie in dem Sleaford-Mods-Dokufilm „Invisible Britain“. Sie fühle sich nicht repräsentiert von den Privatschul-Politikern und den Mittelklasse-Medien. „Die Arbeiterklasse will sich selber hören und sehen, wie sie tatsächlich ist“, sagt McKenzie. Und sie glaubt, dass die „Sleaford Mods“ ihr genau das bieten.
Bei Konzerten ist der Track „Jobseeker“ immer ein Höhepunkt. Er erschien erstmals auf dem 2007 erschienenen Album „The Mekon“. Williamson arbeitete damals noch mit Parfrement zusammen. Der unterlegte Willamsons Sprechgesang mit einem Sample aus „For Your Love“ von den Yardbirds. Das klingt sehr catchy und auch sehr dramatisch, überzieht aber das wütende Poem Willamsons mit einer merkwürdigen Nostalgie-Rostschicht. Das 2013 aufgenommene Remake mit Andrew Fearn dagegen ergänzt die Lyrics mit den für ihn typischen eigentümlichen Beats.
„Jobseeker“ begleitet einen Arbeitssuchenden ins Jobcenter. Die Lyrics setzen sich aus fünf anschaulichen Szenen zusammen (Die Einteilung in Szenen stammt vom Autor).
Szene 1
(So Mr. Williamson, what have you done to find gainful employment since your last signing on date?)
Fuck all!
Szene 2
19.4 – top
18.6 – middle Rob?
19.2 – top
18.4 – mate, middle
Szene 3
Jobseeker!
Can of Strongbow, I’m a mess
Desperately clutching onto a leaflet on depression
Supplied to me by the NHS
It’s anyone’s guess how I got here
Anyone’s guess how I’ll go
I suck on a roll-up – pull your jeans up
Fuck off, I’m going home
Szene 4
Jobseeker!
So Mr. Williamson, what have you done in order to find gainful employment
Since your last signing on date?
Fuck all
I’ve been sat around the house wanking
And I want to know why you don’t serve coffee here
My signing on time is supposed to be ten past eleven
It’s now twelve o’clock
And some of you smelly bastards need executing
Szene 5
Mr. Williamson your employment history looks quite impressive
I’m looking at three managerial positions you previously held with quite
Reputable companies, isn’t this something you’d like to go back to?
Nah, I’d just end up robbing the fucking place
You’ve got a till full of 20s staring at you all day
I’m hardly going to bank it
I’ve go drugs to take, and a mind to break
Jobseeker!
Die erste Szene ist kurz. Der Jobcenter-Angestellte, stellt seine charakteristische Frage. Die zweite Szene wirkt zunächst etwas kryptisch. Es scheint sich um ein Gespräch zu handeln. Zwei Menschen sprechen über eine Zahlenreihe. Angeblich bezieht sich diese Textstelle auf einen von Williamsons Klein-Jobs. Es handelt sich wohl um Temperaturmessungen bei Küken auf einer Hühnerfarm. In der zweiten Szene wird also einer der eintönigen, schlecht bezahlten Arbeitsplätze beschrieben.
Szene 3 ist ein Schnappschuß im Wartebereich des Jobcenters: Da sitzt der Jobseeker. Die Cider-Dose in der Hand. Die selber gedrehte Zigarette im Mund. Er klammert sich an eine Infobroschüre des „National Health Service“ über Depressionen. Der Poptheoretiker Mark Fisher hat sich mit dem Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Depression beschäftigt. Fisher ist der Ansicht, dass der Kapitalismus durch den Neoliberalismus zu einer Art ewiger Gegenwart mutiert sei. Die Utopien seien verschwunden. „Wie konnte sich nur das Gefühl so weit verbreiten, dass es eine Alternative nicht geben kann, wieso können wir uns heute eher das Ende der Welt vorstellen als das Ende des Kapitalismus?“, schrieb Fisher. Diese Alternativlosigkeit verwandelt gesellschaftliche Probleme in private Probleme. Du hast keine Arbeit? Wenn du wirklich arbeiten willst, dann findest du auch eine Arbeit! Das ständige Gefühl des Ungenügens führt laut Fisher zu einer Art gesamtgesellschaftlicher Depression. Genau das macht Williamson mit seiner Beschreibung sichtbar und fühlbar. „Es geht darum“, sagt er im Interview mit Varsity, „wie man sich trotz eines Arbeitsplatzes verloren und nutzlos fühlt.“
Die vierte Szene spielt im Büro. Williamson antwortet auf die Frage, was er denn unternommen habe, um Arbeit zu finden. Die Antworten entblößen die Erniedrigung, die diese Frage enthält. Die Demütigung, sich eingestehen zu müssen, was man zu Hause gemacht hat. Die Demütigung, endlos in einem überfüllten Flur warten zu müssen. Die Demütigung, neben anderen verwahrlosten Arbeitslosen sitzen zu müssen.
In der fünften Szene wird das Gespräch fortgesetzt. In typischen Jobcenter-Phrasen stellt der Angestellte fest, dass der Jobseeker doch schon gute Arbeitsplätze mit Verantwortung gehabt habe, bei Unternehmen mit gutem Ruf, und warum er da denn nicht wieder hin wolle? Man hört schon den gelangweilten Tonfall des Angestellten. Man sieht ihn gelangweilt von den eigenen Phrasen blicklos in der Akte blättern. Man hört die Wanduhr ticken. Und auch wenn es nicht so gemeint ist, die Fragen des Job-Center-Menschen wirken zynisch, wenn man weiß, um welche Art von Arbeitsplatz es geht. Und auch wenn es nicht so gemeint ist, wirken die Fragen kalt und verständnislos. Williamson antwortet das, was man als Arbeitsloser in dieser Lage immer schon mal sagen wollte. Er habe Angst, dass er den Laden irgendwann ausraube, weil er ständig in eine volle Kasse schauen müsse. Den ganzen Tag in eine Kasse voller Zwanzig-Pfund-Scheine zu starren, kann durchaus eine Herausforderung sein, wenn man selber für nicht mehr als ein Butterbrot arbeitet. Man sieht Williamson vor sich, wie er in einem schlecht sitzenden Anzug auf den richtigen Moment wartet, sich die Scheine zu krallen, abzuhauen und sich anschließend abzuschießen, um das eigene Elend nicht mehr spüren zu müssen.
Es gibt nichts Vergleichbares
Fünf Szenen, in denen die totale Erniedrigung eines Arbeitssuchenden durchgespielt wird. Aber kein Arbeitsloser, der weiterhin Arbeitslosengeld bekommen will, könnte es sich leisten, die Antworten aus „Jobseeker“ zu geben. Jeder Arbeitslose weiß, welchen Text er aufsagen muss. Man kann sich den steifen Ablauf eines solchen Gespräches gut vorstellen. Tut mir leid, muss der Jobseeker sagen, ich hab wirklich alles versucht. Beide Gesprächspartner wissen, dass sie eigentlich nur ein Skript mit klar verteilten Rollen durchspielen. Beide wissen, dass ihr Text reine Heuchelei ist. Seine Wucht bekommt Williamsons Text dadurch, dass er ausspricht, was alle wissen, aber nicht sagen. Der Sozialstaat als Farce.
Williamson formuliert keine Dichtung. Keine Rhymes wie im Hip Hop. Es gibt keine Metaphern. Er greift in seinem Text auf Gesprächsfetzen und kursierende Phrasen zurück. Der Musikwissenschaftler Holger Schulze nennt das Partikelpoetik. „Kursierende Partikel“, schreibt Schulze, „werden lediglich in neuen Umarbeitungen anders angeordnet und vorgestellt.“ Die Partikelpoetik verbindet das Politische mit dem Persönlichen, das Autobiographische mit dem Gesellschaftlichen. Williamson wird zum Medium der Erfahrungen der abgehängten Arbeiterklasse, indem er die stumpfen Phrasen des Jobberaters mit den Beschimpfungsklischees der Pubsprache zusammenprallen lässt. Schulze nennt das „ubiquitäres Schreiben“: „Herauskopieren, Überführen, Einfügen, Modifizieren, Rekombinieren, Umkomponieren, Ausfabulieren, Weiterschreiben, Umschneiden, Neuordnen.“
Was Jason Williamson mit Worten macht, das macht Andrew Fearn mit Klängen. Fearn deterritorialisiert seine Sounds. Der österreichische DJ Didi Neidhart bezeichnet das als „Fissionen“ – „Fission“ definiert als das Gegenteil einer „Fusion“. Als klare Auftrennung. „Fissionen kontrollieren und disziplinieren ihr sonisches Material nicht.“ Außerdem verweigere sich fissionäre Musik jeglicher Nostalgie. Fissionen, meint Neidhart, wollten ein neues „Nicht-Genre“ erschaffen. Fearns LoFi-Sounds machen genau das. Sie entfremden, befremden und verfremden. Es gibt keine Harmonien. Nur klare, treibende Dissonanzen. Zusammen mit Williamsons Texten ist das tatsächlich ein einzigartiges Nicht-Genre. Musikjournalisten verheben sich immer wieder an Vergleichen. Aber es gibt nichts Vergleichbares.
Die Sleaford Mods sind das Medium für einen Text und für eine Musik, mit unendlich vielen Autoren. Und vielleicht ist es ja das, was die Soziologin Lisa McKenzie meint, wenn sie sagt, die Sleaford Mods seien diejenigen, die es der unsichtbaren Arbeiterklasse ermöglichen, sich zu sehen, wie sie ist. Das ist keine Authentizität, sondern das Auffischen von in der Sprache zerstreuten Subjektivitäten. Die Kunst der Sleaford Mods bildet eine Affektlandschaft, welche die Working Class in Resonanz versetzt.
Oder wie es die Musikwissenschaftlerin Anahid Kassabian beschreibt: „Identität findet sich nicht in einem einzelnen Subjekt, eher findet sie sich als Strom durch ein Feld, welches sich unaufhörlich, je nach den Umständen, in unterschiedliche Formen und Umrisse verwandelt.“