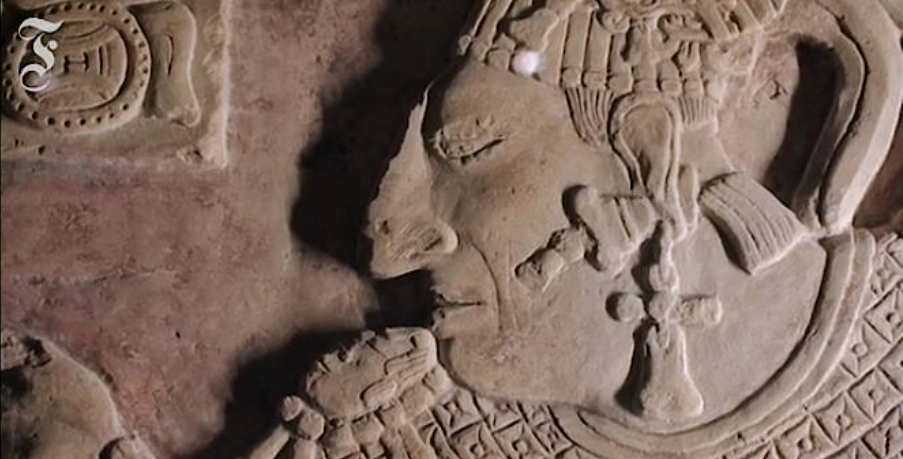Vor mehr als zweihundert Jahren formulierte Wilhelm von Humboldt seine berühmt gewordenen Gedanken zur Universität. Was ist von seinem Bildungsideal an heutigen Hochschulen geblieben? Eine Erinnerung aus aktuellem Anlass.
***

Wilhelm von Humboldt wurde im Jahr 1809 mit der Leitung der „Sektion des Kultus und des öffentlichen Unterrichts“ in Preußen betraut. Preußen befand sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Krieg mit Frankreich und hatte 1806 eine so schwere Niederlage gegen die napoleonischen Truppen erlitten, dass es große Teile seines Staatsgebiets verlor. Daraufhin leitete König Friedrich Wilhelm III. Neuerungen in die Wege, die unter dem Namen „Preußische Reformen“ in die Geschichte eingegangen sind. Diese Reformen wurden großflächig auf den Ebenen der Verwaltung, des Militärs, der Städteordnungen und schließlich auch im Bereich der Bildung durchgeführt; für die Umsetzung der letzteren wurde Wilhelm von Humboldt vorgesehen. Er sollte sowohl Ideen für eine Reform des preußischen Schulsystems entwickeln als auch an der Gestaltung der neu zu gründenden „Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin“ mitwirken.
Humboldt verfasste Zeit seines Lebens diverse Schriften rund um das Thema Bildung. In seiner bekanntesten Schrift zum Universitätswesen, „Über die innere und äußere Organisation der wissenschaftlichen Anstalten in Berlin“ formulierte Humboldt einige Gedanken, die uns bis heute beschäftigen. Der „Hauptgesichtspunkt“ von Universitäten solle die Wissenschaft sein, schreibt er. Die Universität bildet die Spitze des Bildungssystems. Die Schule soll als elementare Einrichtung eine umfassende Allgemeinbildung vermitteln, auf das Berufsleben vorbereiten und die Schüler zugleich dazu befähigen, ein Studium an der Universität aufzunehmen.
Wie der Titel der Denkschrift nahelegt, beschäftigt sich Humboldt separat mit einer inneren und einer äußeren Ausgestaltung von Universitäten. Zur äußeren Organisationsform schreibt er: „Der Staat muss seine Universitäten weder als Gymnasien noch als Specialschulen behandeln, und sich seiner Akademie nicht als einer technischen oder wissenschaftlichen Deputation bedienen.“ Humboldt sieht das Einwirken des Staates als sinnvoll und notwendig an, um die Existenz von Universitäten abzusichern. Sie sollen als Institutionen einen festen und beständigen Platz in der Gesellschaft einnehmen können und zudem von finanziellen Nöte in Forschung und Lehre nicht behelligt werden. Der Staat soll nicht nur die Freiheit der Wissenschaft garantieren, sondern auch bei der Auswahl der Wissenschaftler maßgeblich mitbestimmen. Die Wissenschaft solle zunächst für ihre eigenen Zwecke und frei von politischen oder wirtschaftlichen Zwängen betrieben werden, diene auf diese Weise früher oder später aber auch den Interessen des Staates.
Bekenntnis zu Humboldt
Würde Humboldt den heutigen Zustand der Bildungslandschaft gutheißen? Einerseits können staatliche Universitäten heute vom Staat eröffnet und geschlossen werden und Professoren sind Staatsbeamte, was durchaus Humboldts Idealvorstellung entspricht. Andererseits reicht die staatliche Förderung, von der die Universitäten abhängig sind, oft nicht aus. Zwar gibt es zusätzliche Förderungen durch öffentliche Einrichtungen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die akademische Projekte unterstützen, aber dies führt nach Einschätzung vieler zu einer großen Produktion überflüssiger Texte und zu unsinniger Bürokratie. Die Finanzierung der Wissenschaft durch Drittmittel würde Humboldt sicher nicht befürworten: Faktisch wird die Freiheit der Wissenschaft an Universitäten beeinträchtigt und staatlichen und wirtschaftlichen Interessen untergeordnet.
Auch was die Auswahl und Finanzierung von wissenschaftlichen Mitarbeitern angeht, kommt der Staat seinen Pflichten nicht ausreichend nach. Der „akademische Mittelbau“, der aus Assistenten, Hilfskräften und am Lehrstuhl angestellten Spezialisten besteht, ist im Regelfall mit befristeten Verträgen und niedrigen Löhnen konfrontiert. Humboldts Urteil würde insgesamt vermutlich lauten, dass der Staat die Freiheit der Wissenschaft aktuell nicht ausreichend garantiert und fördert. Würde man versuchen, Humboldts Idealen gerecht zu werden, würde die Situation deutlich anders aussehen: Stellen im akademischen Mittelbau müssten staatlich stärker gefördert werden, um finanzielle Sicherheit und berufliche Perspektiven für Wissenschaftler zu schaffen.
Zwar sind Universitäten heute wissenschaftliche Großbetriebe und mit den Institutionen zu Humboldts Zeiten kaum zu vergleichen, andererseits beziehen sich staatliche Universitäten noch immer auf ein humboldtsches Bildungsideal. So beruft sich die Humboldt-Universität zu Berlin (die frühere „Friedrich-Wilhelms-Universität“) auf seine Idee der Autonomie von Universitäten: „Unter ihrem Anspruch bekennt sich die Humboldt-Universität zu Berlin zur Einheit von Forschung und Lehre, zur Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, zum Programm des forschenden Lernens sowie zur institutionellen Verantwortung der akademischen Selbstverwaltung“, so steht es in der Präambel der Universitätsverfassung. Die Werte und Ideale, zu denen sich andere Universitäten bekennen, klingen ähnlich.
Die Sorgfalt des Staates
Wie stellt sich Humboldt nun die Arbeit an Hochschulen vor? Einerseits postuliert er „Einsamkeit und Freiheit“ als vorherrschende Prinzipien für die innere Organisation von Universitäten. Andererseits plädiert er dafür, dass Forschung nur in Zusammenarbeit sinnvoll gelingen und eine langfristige Wirkung haben kann. Die Wissenschaft soll als ein „noch nicht ganz aufgelöstes Problem“ behandelt werden, wodurch sich das Wesen der Universität für Humboldt grundlegend von dem der Schule unterscheidet. In der Schule seien die Kenntnisse abgeschlossen und würden auch als solche vermittelt, während die Forschung an der Universität etwas Unfertiges, sich Entwickelndes darstelle, an dem stetig gearbeitet werden müsse. Wissenschaft solle als etwas „noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes“ gesehen werden. Folge jeder diesem Prinzip, werde das gemeinschaftliche Forschen und Lehren Humboldt zufolge wie von selbst funktionieren.
Humboldts Auffassung von Bildung ist stark von den Ideen der Aufklärung und des Humanismus geprägt: „Der wahre Zweck des Menschen ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste, und unerlässliche Bedingung“, schreibt er schon 1792 in seiner Abhandlung „Wie weit darf sich die Sorgfalt des Staates um das Wohl seiner Bürger erstrecken?“. Humboldts Idealvorstellung entspricht also einer Form von Wissenschaft, bei der die Bildung und die Freiheit des Individuums im Vordergrund stehen.
Alte, neue Fragen
Würde man Humboldt zur inneren Organisation von heutigen Universitäten befragen, so hätte er vermutlich einiges zu kritisieren. Weder seine Idee einer Einheit von Forschung und Lehre noch die Freiheit der Wissenschaft oder gar die aktive Beteiligung von Studenten an der Forschung sind in unserem aktuellen Hochschulsystem Realität.
Folgende, auch für Humboldt relevante Fragen sollten neu diskutiert werden: Wie können Lehre und Forschung sinnvoll verbunden werden? Was bedeutet akademische Freiheit, und wie können junge Menschen an Universitäten derart gebildet und gefördert werden, dass ihre geistigen Fähigkeiten zur vollen Entfaltung kommen?
Zweck und Aufbau von Bachelor- und Masterstudiengängen sollten neu überdacht werden. Eigentlich soll das Masterstudium heute ja einer Vertiefung der im Bachelor erworbenen Kenntnisse dienen. In der Realität gestaltet es sich aber oft als reine Fortführung des Bachelors: Zahlreiche Prüfungen führen zu einer anhaltenden Verschulung, Studenten nehmen selten an Konferenzen und Tagungen teil, die Masterarbeit wird trotz ihres hohen Anspruchs wissenschaftlich nicht anerkannt.
Wie könnte die Universität aussehen, wenn man Humboldts Ziele kompromisslos umsetzen würde? Sie könnte zu einem Ort des wissenschaftlichen Austauschs werden, an dem Forschung und Lehre zum Beispiel dadurch stärker verzahnt würden, dass Professoren ihre Studenten in Forschungsarbeiten einbinden. Seminare und Übungen gestalteten sich nicht länger als Frontalunterricht mit gelegentlichem Gespräch, sondern dienten in erster Linie der Diskussion aktueller und relevanter Forschungsfragen. Warum werden Bachelor- und Masterarbeiten nicht grundsätzlich veröffentlicht und in Universitätsbibliotheken zugänglich gemacht?
Für den akademischen Mittelbau würde Humboldts Ideal eine erhebliche Verbesserung bedeuten. Als vom Staat eingesetzte Akademiker würden sie in ihrer Stellung als Spezialisten und Experten respektvoller wahrgenommen und gefördert werden.
Humboldts Ideale bieten auch heute noch viel Potential für die Ausgestaltung der Universitäten. Doch momentan ist zum Beispiel die Einheit von Forschung und Lehre nichts weiter als eine Idealvorstellung. Dabei ließe sich durch wenige Änderungen der universitären Strukturen die Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, die „universitas magistrorum et scholarium“, wie sie schon im Mittelalter existierte, neu beleben. Denn so, wie es im Moment um die Hochschulen in Deutschland bestellt ist, kann es nicht weitergehen.