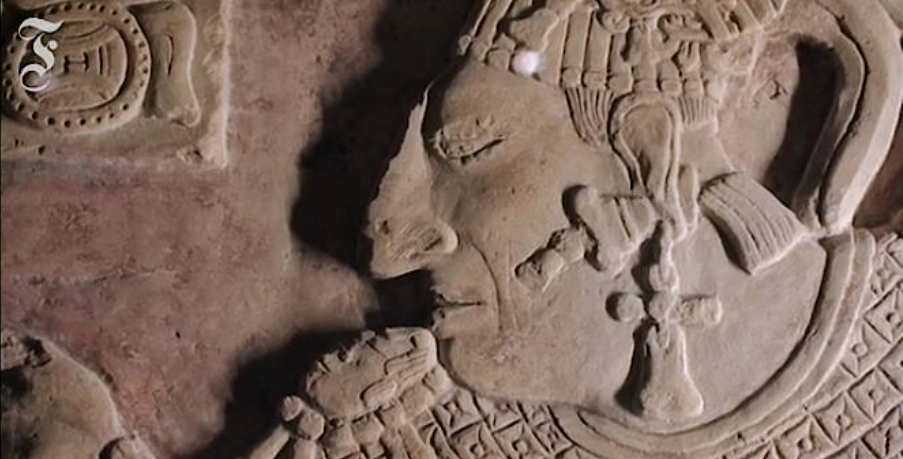Viele Studenten fragen sich, wie es nach dem Studium weitergehen soll. Wann ist eine Promotion das richtige, auf welche Arbeitsbedingungen sollte man sich einstellen? Erster Teil unseres Leitfadens.
***

Alle Studierenden müssen sich früher oder später mit der Frage auseinandersetzen, ob sie eine Laufbahn an der Universität oder auf dem freien Arbeitsmarkt beginnen möchten. Entscheiden sie sich für die Universität, steht das Schreiben der eigenen Doktorarbeit auf dem Programm. Doch der Weg zum Doktortitel birgt einige Herausforderungen, und es gibt viel, was man vorab darüber wissen sollte. Zwei Lehrende und zwei Promovierende der Georg-August-Universität Göttingen erzählen im Gespräch, was es zu beachten gibt.
Vorweg ein paar wichtige Begriffe: Die offizielle Bezeichnung für eine Doktorarbeit ist die Dissertation. Dabei handelt es sich um die erste eigene wissenschaftliche Arbeit größeren Umfangs zu einem noch unbearbeiteten Thema. Wenn die Doktorarbeit erfolgreich vollendet wurde, steht die Promotion an: Das ist die Verleihung eines akademischen Grades, des Doktors. Jemand, der eine Doktorarbeit schreibt, wird deshalb in diesem Artikel als Promovierender oder Doktorand bezeichnet. Die Promotion ermöglicht es dem Absolventen, an einer Universität zu forschen und zu lehren. Sie ist somit zugleich der Schlüssel zu einer beruflichen Karriere an der Universität.
Wer sich dazu entschließt, eine Doktorarbeit zu schreiben, sollte bereits eine Idee davon haben, was er im Anschluss beruflich machen möchte und sich fragen, ob eine Promotion dafür notwendig ist oder zumindest später Vorteile auf dem Arbeitsmarkt bringen könnte.
Durststrecken und frustrierende Erfahrungen
Barbara Schaff, die als Professorin für Englische Philologie an der Universität Göttingen regelmäßig Promovierende betreut, rät: „Hinter der Entscheidung für eine Promotion sollte ein klares Berufsziel stehen. Strebt man eine Promotion nur an, weil man sich davon bessere Jobchancen oder ein höheres Gehalt erhofft, dann sollte man es lieber lassen.“ Am wichtigsten sei es allerdings, intellektuelle Neugier für das eigene Fach und die eigenen Themen zu haben.
Das sieht Valentin Blomer ähnlich, der als Professor für Mathematik an der Universität Göttingen lehrt. „Ein Promovierender sollte eine Mischung aus Talent, Spaß und Fleiß mitbringen“, findet er, „aber ganz besonders Enthusiasmus ist wichtig. Ohne Freude und Interesse an der eigenen Arbeit kann man eine Promotion nicht schaffen, weil sonst das notwendige Durchhaltevermögen fehlt. Dann wird ein Doktorand auch kaum eine Zukunft in seinem gewählten Bereich haben.“
Von der Universität wird für die Anfertigung einer Doktorarbeit meist ein Zeitraum zwischen drei und fünf Jahren vorgesehen; die tatsächliche Dauer ist aber von vielen Faktoren abhängig – etwa von der Fragestellung, der Arbeitsweise und den persönlichen Lebensumständen des Promovierenden. Am besten ist es, sich mit den Lehrenden des eigenen Fachs über den Rahmen der individuellen Arbeit zu unterhalten.
Da die Promotionszeit mehrere Jahre in Anspruch nimmt, sollte ein angehender Doktorand bereit sein, viel Zeit in die Doktorarbeit zu stecken und immer wieder neue Motivation aufbringen können, wenn es mal nicht so läuft wie geplant. „Man muss sich auf Durststrecken und auch auf frustrierende Erfahrungen während der Promotionszeit einstellen. Das gehört dazu, wenn man über einen so langen Zeitraum an einem einzigen, sehr spezifischen Thema arbeitet“, sagt Vania Morais, die ihre Doktorarbeit derzeit am Institut für Romanische Philologie der Universität Göttingen schreibt. Sie findet es wichtig, beim Schreiben nicht den roten Faden zu verlieren und sich immer wieder vor Augen zu halten, welche Fragen die Doktorarbeit behandeln soll.
Unterstützung in Graduiertenschulen
Wenn man eine Idee für die Doktorarbeit hat, muss man sich für einen Weg entscheiden, auf dem man promovieren möchte. Das bekannteste Format ist die Individualpromotion, die auch Dominique Franke gewählt hat. Sie schreibt ihre Doktorarbeit im Fach Ur- und Frühgeschichte und wusste schon während des Studiums, dass sie promovieren möchte. „Ich habe mich mit meiner Idee für die Doktorarbeit gezielt an einen Professor gewendet, der einen ähnlichen Forschungsschwerpunkt hatte wie ich. Allerdings hat er mir ein anderes Thema vorgeschlagen, welches ich jetzt bearbeite. Es läuft nicht alles immer nach den eigenen Vorstellungen bei der Promotion“, erzählt Franke. Der Vorteil einer Individualpromotion ist, dass der Promovierende alle aufkommenden Fragen und Probleme unmittelbar mit dem Betreuer klären kann.
Wer direkt bei seinem Doktorvater oder seiner Doktormutter promoviert, hat manchmal die Möglichkeit, zusätzlich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl des Betreuers zu arbeiten. Wenn keine Stelle frei ist, kann die Promotion auch extern erfolgen, was allerdings ganz eigene Schwierigkeiten birgt. „Eine Individualpromotion ist insofern von Vorteil, als man nicht programmgebunden promoviert und somit auch zeitlich ungebunden ist. Dafür muss man sich aber auch um die eigene Finanzierung kümmern und eine enorme Selbstdisziplin mitbringen. Man muss sich auch der Einsamkeit des Forschenden bewusst sein, denn eine Promotion in den Geisteswissenschaften ist erstmal eine sehr einsame Angelegenheit. Deshalb empfehle ich immer, sich mit anderen Promovierenden oder wissenschaftlichen Mitarbeitern im Fach auszutauschen“, sagt Professorin Barbara Schaff.
Unterstützung während der Promotionszeit finden Individualpromovierende in Graduiertenschulen, die häufig an Universitäten angeschlossene Einrichtungen sind und dazu dienen, die Doktoranden miteinander zu vernetzen und zu fördern – etwa durch Reisekostenbeihilfe, Kurzstipendien und vor allem durch Beratung. Die Schulen arbeiten fächerübergreifend und binden sowohl Individualpromovierende als auch solche aus Promotionsprogrammen ein. So gibt es beispielsweise in Göttingen vier Graduiertenschulen, in die alle Promovierenden durch ihre Einschreibung an der Universität aufgenommen werden: Eine für Geisteswissenschaften, eine für Sozialwissenschaften, eine für Naturwissenschaften und eine für Forst- und Agrarwissenschaften.
Zusammenarbeit mit Anderen oder individuelle Betreuung?
Promovierende, die sich eine Zusammenarbeit mit anderen zu einem bestimmten Thema wünschen, können ihre Doktorarbeit auch in einem Graduiertenkolleg schreiben. Die Graduiertenkollegs werden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert und sind zeitlich begrenzte Forschungsprogramme mit einem klaren thematischen Schwerpunkt. Da die Kollegs meistens interdisziplinär ausgerichtet sind, können sich die Promovierenden bei ihren Arbeiten gegenseitig unterstützen. Die DFG vergibt Stipendien und Stellen für Graduiertenkollegs, auf die sich Promovierende direkt bewerben können (siehe auch den Stipendienlotsen des Bildungsministeriums).
„Am besten ist es, sich zu überlegen, welcher Weg für einen persönlich infrage kommt“, rät Professorin Barbara Schaff. Lege ich Wert auf enge Zusammenarbeit mit Anderen oder auf individuelle Betreuung? Möchte ich möglichst frei und ungebunden arbeiten oder ein strukturiertes Programm haben, in dem ich mich bewege? Hilfe können sich Studierende nicht nur bei den Beratungsstellen einzelner Universitäten, sondern auch direkt bei den Graduiertenschulen und der DFG holen.
Neben grundsätzlichen Fragen ist die Promotion mit weiteren organisatorischen Aspekten verbunden – etwa, wie eine Doktorarbeit finanziert werden kann und wie es mit Berufsperspektiven aussieht. Darum soll es in einem zweiten Artikel gehen, den wir in der kommenden Woche im Blog veröffentlichen.