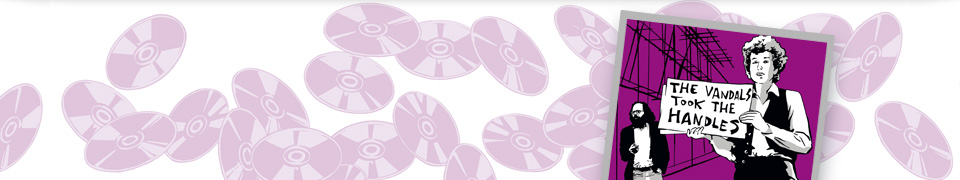Der Name „lyrics“ für die Texte der Popmusik ist nicht einfach das englische Wort für Lyrik. Wie unterscheiden sich Songtexte und Gedichte? Wen rühmt, worüber klagt Pop? Diese und andere Fragen behandelt unsere neue Online-Anthologie.
***
 © dpaSzene aus dem Musik-Video „Wrecking Ball“ mit Miley Cyrus
© dpaSzene aus dem Musik-Video „Wrecking Ball“ mit Miley Cyrus
Lyrik steht im Ruf, die individualistischste aller literarischen Gattungen zu sein. Die Stimme eines Einzelnen spricht zu Lesern, die ebenfalls als Einzelne vorgestellt werden. Die Rede ist vom „lyrischen Ich“ und vom „lyrischen Du“. Daran schließen sich alle möglichen Assoziationen von Einsamkeit, Empfindlichkeit, Innerlichkeit an. Dass die Lyrik, anders als Roman und Theaterstück, ihr Publikum selbst dann selten in Zehntausenden zählt, wenn sie erfolgreich ist, unterstreicht solche Verbindungen.
Der Germanist Heinz Schlaffer hat – in seinem fabelhaften Buch „Geistersprache. Zweck und Mittel der Lyrik“, München 2012 – darauf hingewiesen, dass am Anfang der Lyrik alles genau umgekehrt war. Historisch entspringt das Gedicht kollektiven Praktiken. Es ist Gesang, Preis von Helden, Beitrag zu Festen. Lyrik wird als Ode oder Hymne begleitet von Musik und Tanz, deren Rhythmus sie in sich aufnimmt. Sie will laut vorgetragen werden. Der Reim ist ein Klangereignis und schon insofern ein öffentliches. Und auch die Stoffe der Lyrik sind überindividuelle: Olympische Sieger wurden gerühmt, die Götter angerufen, die Geister beschworen und eine Welt angedichtet, die als beseelt wahrgenommen wurde. Die Frühgeschichte der Lyrik ist eine Geschichte des „O!“
Vieles erinnert an die Anfänge
Nur die Frühgeschichte? Wer Rilkes Sonette an Orpheus oder seine Elegien liest, wird ebenso eine Erinnerung an die ursprünglichen Funktionen des Gedichts finden wie der Leser der Hymnen Hölderlins. Doch der poetische Sprechakt ist hier kein kollektiver mehr, die Beseeltheit des Kosmos, die Nähe der Götter nurmehr eine Erinnerung, und die Dichter wissen auch keine tatsächlichen Kollektive mehr um sich, vor sich, hinter sich. Zwar hat im vergangenen Jahrzehnt durchaus zugenommen, was es immer gab: die Dichterlesung, die Rezitation und, neudeutsch, der „poetry slam“. Dichter touren mit Jazzbands, Gedichte werden vertont und gehen so in das musikalische Gedächtnis ein. Manche Lyriker, man denke an Wilhelm Müller, kennen die meisten nur darüber. Doch trotz Bertolt Brecht werden die wenigsten Gedichte mitgesungen. Selbst dem großen Peter Rühmkorf gelang das wohl nur selten.
In Schlaffers Lyriktheorie wird eine Ausnahme erwähnt – und dann nicht weiter behandelt: die Popmusik. Hier erinnert vieles an die Anfänge. Der Lyriker, mitunter ein Star, aber nicht immer der Vortragende, zählt sein Publikum in Hunderttausenden. Die Zuhörer kommen in Stadien, um den Vortrag zu hören, sie singen mit, es wird zu den Liedern getanzt, es wird gefeiert und wie in der Antike sind mitunter auch die Drogen nicht weit.
Ist also eine ursprüngliche Funktion der Poesie in die populäre Musik abgewandert? Wie verhalten sich dort Klang und Text, musikalischer Klang und Textklang? Wen rühmt, worüber klagt Pop? Wenn der Eindruck nicht täuscht, haben wir es oft mit einer Überlagerung zu tun, von kollektiver Praxis des Mitsingens und ritualisiertem Dabeisein einerseits, durchaus aber zuweilen innerlicher, modern-lyrischer Mitteilung der Texte. Doch für eine kompakte These ist die Landschaft des Pop zu vielfältig. Es gibt in ihr alles und sein Gegenteil: Texte, die auf Melodien gedichtet werden, Vertonungen schon bestehender Texte, Ballade und Sprechgesang, Schlager und Ausgriffe ins Epische. Die Popmusik ist auch in ihren Texten ein uneinheitliches Gebiet. Das mussten nicht zuletzt Exegeten erfahren, die in der Popmusik kritische Potentiale suchten und sich gewissermaßen erträumten, dass die Zeitdiagnostik samt der Sehnsucht nach dem richtigen Leben um 1968 herum in Schallplatten eingewandert ist.
Ein Popsong – eine Interpretation
 © dpaAbba oder: Wie macht man einen Ohrwurm?
© dpaAbba oder: Wie macht man einen Ohrwurm?An diesem Samstag erhält ein Popmusiker, Bob Dylan, den Nobelpreis für Literatur. Ganz gleich, wie man das findet – der Vorgang selbst macht auf eine Sache aufmerksam: dass es literarische Texte gibt, die Millionen Menschen bekannt sind. Es liegt auf der Hand, dass sie diese Bekanntheit nicht allein als Texte erreicht hätten. Niemand würde „A Hard Day’s Night“ kennen, wenn es nicht gesungen worden wäre, niemand könnte „Money, Money, Money“ lesen, ohne die Melodie im Ohr zu haben. Und doch wird umgekehrt niemand behaupten, die Beatles oder Abba hätten mit demselben Erfolg auch einfach nur ständig Vokale singen können. „Just, la la la la la“ (ATC) und „La da da dee da da da da“ (La Bouche) bleiben die Ausnahme.
Was es mit den „lyrics“ der Popmusik auf sich hat, soll von diesem Samstag an in einer besonderen Variante der „Frankfurter Anthologie“ erkundet werden: der „Frankfurter Pop-Anthologie“, die an dieser Stelle alle zwei Wochen erscheinen soll. Ein Popsong – eine Interpretation, ganz entsprechend der Form, die Marcel Reich-Ranicki der fortlaufenden Lyrik-Anthologie gegeben hat, als er sie 1974 gründete.
Um einem kulturkritischen Reflex sogleich vorzubeugen: Die Frankfurter Pop-Anthologie hat nicht vor, irgendetwas „aufzuwerten“, beispielsweise schlechte Texte oder laute Musik, einen Trend zu verstärken, etwa den zur englischen Sprache, oder gar irgendetwas „abzulösen“, beispielsweise gute Gedichte und ihre Deutung. Sie behauptet auch nicht, dass Popsongs Gedichte sind. Sie nimmt sich nur vor, einen Bereich lyrischer Produktion auszuleuchten, der das aufgrund seines Erfolgs, seines Umfangs, seiner Aufschlusskraft und mitunter auch aufgrund seiner Qualität verdient.
Wie eine Abrissbirne
Dabei sind die Voraussetzungen der Interpretation oft ganz andere als bei Gedichten. Die geben sich zumeist als kleine Rätsel, die lösen zu sollen als Aufgabe gleich mitgegeben wird, auch wenn das Schloss, nach einer Formulierung Theodor W. Adornos, immer wieder zuschnappt. Viele Texte von Popsongs sind wenig rätselhaft. Viele sind Kitsch. Manche ahmen aber auch nach, wie hilflos Rede sein kann, wenn sie nur über leicht verständliche Sprache verfügt: „I came in like a wrecking ball / I never hit so hard in love / All I wanted was to break your walls / All you ever did was wreck me …I never meant to start a war / I just wanted you to let me in / And instead of using force / I guess I should’ve let you win.“ Das kann als eine Abfolge von Versatzstücken gelesen werden, als Auszug aus dem Register der Liebesend-Metaphern, in dem sich der Wunsch der Liebe, Zugang zu finden, über die ruinösen Wirkungen des rücksichtslosen Versuchs mit der Motivkette „Krieg–Gewinnen–Verlieren“ verbindet. Das führt aber zugleich vor, wie verzweifelte Einsicht zu Bildern greift, die das Gemeinte nur so treffen wie eine Abrissbirne etwas trifft. Niemand, der in der Situation wäre, würde dem Lied vorhalten, seine Bilder stimmten nicht ganz.
Zugleich wird niemand nur darum gleich Miley Cyrus als Nachfolgerin von John Donne oder Heinrich Heine bezeichnen. Der im vergangenen Jahr verstorbene Feuilleton-Redakteur Dieter Bartetzko hat in vielen Stücken für diese Zeitung, die dem deutschen Schlager galten, allerdings gezeigt, was einem alles an Erkenntnis zufallen kann, wenn man die Frage nach der Bedeutung und dem Rang solcher Lieder nicht schon für entschieden hält. Herauszubekommen, wodurch es ihnen gelingt, dass so viele etwas an ihnen finden, soll auch in Erinnerung an den Kollegen das wiederkehrende Thema der „Frankfurter Pop-Anthologie“ sein.
***
Die erste Folge wird sich am Samstag mit einem Lied von Niels Frevert beschäftigen. Die Frankfurter Pop-Anthologie wird im Vierzehn-Tages-Rhythmus fortgesetzt.