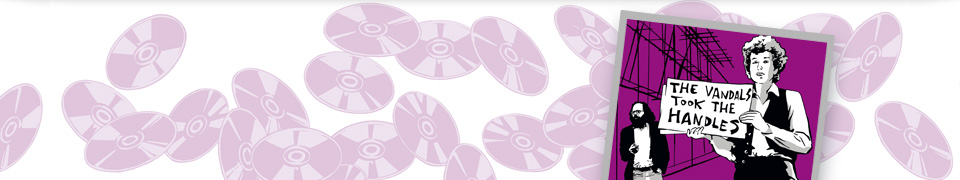Grau, hässlich und apokalyptisch: Morrisseys „Everyday is like Sunday“ verschränkt die Tristesse englischer Seebäder mit Atomkriegsängsten. So poetisch und klug war die Kulturkritik in den Thatcher-Jahren.
***
Morrissey: „Everyday is like Sunday“
Trudging slowly over wet sand
Back to the bench where your clothes were stolen
This is the coastal town
That they forgot to close down
Armageddon, come Armageddon!
Come, Armageddon! Come!
Everyday is like Sunday
Everyday is silent and grey
Hide on the promenade
Etch a postcard :
„How I Dearly Wish I Was Not Here“
In the seaside town
That they forgot to bomb
Come, come, come, nuclear bomb
Everyday is like Sunday
Everyday is silent and grey
Trudging back over pebbles and sand
And a strange dust lands on your hands
(And on your face)
(On your face)
(On your face)
(On your face)
Everyday is like Sunday
„Win yourself a cheap tray“
Share some greased tea with me
Everyday is silent and grey
***
Eine äußerst seltsame Ferienszenerie ist das in diesem Songtext: Sonntag und Strand klingen erst einmal gut, aber dann säuft das Ganze in Stille und Grau ab. Und bevor der erste Refrain erreicht ist, der ohne viel Aufhebens eh schon schnell im Raum steht, ist der nukleare Erstschlag auch schon da. So rätselhaft geht es in dem Song „Everyday is like Sunday“ zu, aber der ist von Morrissey, und Morrissey ist nicht gerade für unterkomplexe Lyrics bekannt. Das erkannte damals auch Chrissie Hynde von den Pretenders: „I find his sense of storytelling, with its irony and poignancy, very moving and believable. The lyric to Everyday Is Like Sunday is, to me, a masterful piece of prose, and I think that is very rare for a modern day songwriter”, schrieb sie, ging hin und coverte den ironischen, ergreifenden Song sofort auf ihrer nächsten Platte.
Aber von vorne. Nachdem „The Smiths“ auseinanderbrachen, veröffentlichte Sänger Morrissey im Jahr 1988, nur wenige Monate nach der Trennung, sein Solo-Debütalbum „Viva Hate“. Und „Everyday is like Sunday“ ist nach „Suedehead“ die zweite Singleauskopplung daraus. Morrissey schrieb stets Texte und Gesangspart und Johnny Marr die Musik, nun muss er sich auf verschiedene Gastschreiber verlassen – auf „Viva Hate“ ist es Stephen Street, ein bewährter Produzent, der auch schon für die Smiths zuständig war.
Die Anglistin möchte zunächst darauf hinweisen, dass das erste Wort des Titels „Everyday“ lautet und nicht „Every“, gefolgt von „day“. Man übersetzt das also eher nicht als „Jeder Tag ist wie ein Sonntag“, sondern „Der Alltag ist wie Sonntag“. Dieser Sonntag ist ein alles mit Lähmung überkrustender Feiertag von der allerödesten Sorte, mit miesem Wetter, mieser Laune, alle Läden zu und Fluchtgedanken. Und er hört nie auf. Das Ganze dann noch in einem britischen Seebad, jenem urenglischen Ort des billigen Spaßes und noch billigeren Alkohols, der Souvenirbuden und Bingohallen. Es ist ein Biotop, das man vermutlich erst einmal erklären muss, denn es gibt hierzulande nichts Vergleichbares. Eventuell hilft es, sich die längst legendären Fotos anzuschauen, die Martin Parr für sein Buch „The Last Resort“ in den Achtziger Jahren von New Brighton (nicht zu verwechseln mit dem ungleich hübscheren Brighton) gemacht hat. New Brighton liegt bei Liverpool, ist ziemlich heruntergekommen, aber das bringt es mit sich, dass sich jeder dort ein Plätzchen an der Sonne leisten kann, und sei es nur ein Handtuch auf einer öden Betonrampe.
 © YoutubeBingohallenbewohnerinnen, Hauptzielgruppe englischer Seebäder in den siebziger und achtziger Jahren.
© YoutubeBingohallenbewohnerinnen, Hauptzielgruppe englischer Seebäder in den siebziger und achtziger Jahren.Vielleicht hilft es auch, sich das offizielle Video anzuschauen, denn es wurde in Southend-on-Sea gedreht – es hätte aber auch Eastbourne oder Blackpool sein können. Üblicherweise gibt es in diesen Seebädern einen Amusement-Pier mit Spielhölle, kleine Fish&Chips-Butzen, in denen man für wenig Geld reichlich frittierte Kalorien kaufen kann, viele Pavillons und viele alte Menschen, die leicht zu unterhalten sind. An den Seebädern Englands ging, bei aller Zeitlosigkeit, die Geschichte dennoch nicht ganz spurlos vorbei. Aus der eleganten Badegesellschaft früherer Jahrhunderte wurde bald ein Massengeschäft, in den Sechziger Jahren wiederum fuhr man dann lieber ins südliche Ausland. Wer Morrisseys Video genau anschaut, sieht zusammen mit der herrlich genervten Protagonistin in den Fernsehgeräten beim Elektronikhändler sowie im Wohnzimmer Ausschnitte der Komödie „Carry on Abroad“ aus dem Jahr 1972, dem vierundzwanzigsten Film der „Carry On“-Reihe. Darin beschließt ein Grüppchen Engländer in einem Pub (wo auch sonst?), gemeinsam auf eine mediterrane Insel zu fahren – man kann es sich ja leisten.
 © Youtube„Carry On Abroad“ im Video
© Youtube„Carry On Abroad“ im VideoEine ganze Zeitlang verrentnerten so die einst mondänen Seebäder im Schatten der Wahrnehmung vor sich hin, manche schulten aus Verzweiflung gar auf Bürostadt um und verschandelten sich dabei fürchterlich mit brutalistischer Betonklotzerei. Heute leben sie ganz gut von Wochenendausflüglern und Junggesellenabschieden mit eisernem Sauf- und Amüsiervorsatz. In der Zeit, in der „Everyday is like Sunday“ entstand, scherte sich kaum jemand um die vergessenen Städte am Südzipfel des Landes. Man hat sie in der Tat einfach vergessen: “This is the coastal town / That they forgot to close down”.
In der Thatcher-Dekade der Achtziger Jahre – The Iron Lady prägte ihre Zeit so stark wie keiner ihrer Nachfolger – geriet so manches in Vergessenheit, auch ganze Berufsstände und Generationen. (Morrissey widmete ihr den Song „Margaret on the Guillotine“.) Wer jung war, versuchte sich angesichts der grassierenden Hoffnungslosigkeit irgendwie durchzuwurschteln, fühlte sich in seinem Land wenig aufgehoben, ergab sich in die bleiernen Umstände, zog sich möglichst einfarbig an und erhob die schlechte Laune zur Kunstform. Es sollte noch ein paar Jahre dauern, bis Anfang der Neunziger alles während der Madchester[sic!]-Raves in Farbe, Drogen und Eskapismus explodierte. Nein, noch ist alles nüchtern, grau und ablehnend. Und sich in einem Café fettäugigen Tee aus schlecht gespültem Geschirr zu teilen noch der Höhepunkt der Romantik: „Share some greased tea with me“.
Jetzt haben wir die Bomben aber noch nicht erklärt, und auch nicht den seltsamen Staub: „And a strange dust lands on your hands (And on your face)“. Und da wird es jetzt wirklich postapokalyptisch, mit nuklearem Fallout und allem, denn dieser Teil des Songs bezieht sich nach Angaben des Künstlers auf den Roman „On the Beach“ (auf deutsch: „Das letzte Ufer“) von Nevil Shute. Die Seaside Town in diesem Buch aus dem Jahr 1957 ist Melbourne, es spielt während eines Atomkriegs, der die Bevölkerung des Planeten fast ausgerottet hat. Nur die Besatzung eines amerikanischen U-Boots und die Einwohner der Stadt Melbourne sind noch am Leben – immerhin so lange, bis die radioaktiven Wolken sie erreichen, die gerade auf sie zuziehen. 1959 wurde der Roman verfilmt, Gregory Peck, Ava Gardner und Fred Astaire spielen die Hauptrollen.
Am Ende wollen in Shutes „Letztem Ufer“ alle dringend, wenn sie schon sterben müssen, das wenigstens in ihrer geliebten Heimat erledigen. Solche patriotischen Sentimentalitäten liegen Morrissey fern. Deshalb müssen wir noch ein paar andere Sprengsätze bemühen, nämlich solche, die einen nicht an den richtigen Ort, sondern in die richtige Zeit zurückbomben. Und mit John Betjeman, einem Dichter und Denkmalschützer aus Passion, findet am Ende alles zusammen: Amusement Pier und Bombe und Promenade und Morrissey. Letzterer nämlich bezeichnete Betjeman mehr als einmal als einen seiner wichtigsten Einflüsse. Es gibt darüber sogar wissenschaftliche Aufsätze: „The Seaside town that they forgot to bomb“ Morrissey and Betjeman on Urban Regeneration and British Identity von Lawrence Foley, in „Morrissey: Fandom, Representation and Identities“, Herausgegeben von Eoin Devereuy, Aileen Dillane und Martin Power, 2011. Wir machen es etwas einfacher und fassen zusammen: Morrissey wie Betjeman glauben fest an die Beeinflussung der Menschen durch die Orte, an denen sie aufgewachsen sind und leben. In beider Werk spielen Gebäude und Städte eine wichtige Rolle, besonders solche, die das Leben im zeitgenössischen England prägen.
 © YoutubeDu bist, wo du wohnst. Und manchmal gibt es kein richtiges Leben im Falschen.
© YoutubeDu bist, wo du wohnst. Und manchmal gibt es kein richtiges Leben im Falschen.Wer einmal in London am Bahnhof St. Pancras ausgestiegen ist – dort hält auch der Eurostar – dem ist vielleicht die Bronzestatue des älteren Herren aufgefallen, die mitten in der Bahnhofshalle steht. Mit einer Hand hält er seinen Hut fest und schaut nach oben in die Architektur. Das ist John Betjeman, und er steht da, weil er sich für die Rettung des Gebäudes eingesetzt hat. Viktorianische Architektur war im London der frühen siebziger Jahre nicht sonderlich beliebt, sie galt als kitschig, überladen und ästhetisch wertlos. Betjeman gründete die Victorian Society und verschrieb sich der Rettung dieser Baudenkmäler. Er ist der Mann, dem wir verdanken, dass es heute noch so viele der alten Eisenpiers in den „Seaside Towns“ gibt und nicht vor lauter gesellschaftlicher Ambition die ganze Südküste zubetoniert wurde.
Wenig Erbarmen hat Betjeman allerdings mit den Erzeugnissen der britischen Architektur der Moderne, die sich bemühte, Le Corbusier so falsch wie möglich zu verstehen und dadurch nahezu unbewohnbare Komplexe in die Gegend stanzte. Für die, und jetzt sind wir wieder bei den Bomben, gibt es eigentlich nur eine Lösung. In einem ziemlich bekannten architekturkritischen Gedicht exerzierte Betjeman das an dem fabrikendurchsetzten Moloch von Slough durch:
„Come friendly bombs and fall on Slough!
It isn’t fit for humans now,
There isn’t grass to graze a cow.
Swarm over, Death!
Come, bombs and blow to smithereens
Those air -conditioned, bright canteens,
Tinned fruit, tinned meat, tinned milk, tinned beans,
Tinned minds, tinned breath.“
… und so weiter. Ironischerweise wurde Slough zwei Jahre später tatsächlich durch Bomben nahezu zerstört, allerdings nicht durch freundliche, sondern ganz und gar feindliche Bomben, nämlich deutsche. Das war 1939. Betjeman bedauerte sein Gedicht dann zwar sehr, Slough wurde danach allerdings auch nicht schöner. Die britische Serie „The Office“ spielt dort, das sagt eigentlich alles.
 © YoutubeUnschöne Malls: Die architektonische Pest des 20. Jahrhunderts
© YoutubeUnschöne Malls: Die architektonische Pest des 20. JahrhundertsEs geht bei beiden Dichtern – nennen wir sie doch mal so – zwar hauptsächlich, aber nicht nur um Architektur. Es geht auch um die Wirkung, die die Ästhetik der Gegenwart auf die Menschen hat: „Tinned minds, tinned breath“ bei Betjeman, bei Morrissey sind es die billigen Vergnügen wie die Losbuden mit ihren Plastikpreisen: „Win yourself a cheap tray“. So ist das nämlich mit Menschen, die in menschenfeindlichen Umgebungen nicht artgerecht gehalten werden: sie werden da nicht gerade zu mündigen, lebensfrohen Individuen erzogen. Sondern zu Herdentieren, die sich mit vorgefertigtem Quatsch abspeisen lassen.
Damit knüpfen beide geradewegs an viktorianische Kulturkritiker wie John Ruskin und die Arts and Crafts-Bewegung an, denen schon die Industrialisierung suspekt war. Sie alle eint eine Nostalgie nach einem echten, unverfälschten Auenland-Britannien der grünen Wiesen und ehrlichen Handwerker. Man kann einen ziemlich großen Teil der englischen Kultur darauf zurückführen, man merkt es nur manchmal nicht, weil alles so ironisch aussieht. So ist das auch bei Morrisseys anderem großen Idol, Oscar Wilde. Bei allem Witz wohnt auch seinem Werk eine Sehnsucht nach Schönheit inne, die angesichts der unschönen, betonierten, menschenfeindlichen Gegenwart ständige Enttäuschung erfährt. Dass man da nicht fröhlich bleiben kann, das versteht sich von selbst. So wurden die Lieder der Smiths wie auch Morrisseys frühes Solo-Werk zu Erkennungsmelodien aller an der Welt verzweifelnder Jugendlicher. Wunderschön zusammengefasst hat das einmal „Ärzte“-Mitglied Farin Urlaub in seiner Smiths-Hommage „Sumisu“:
„Unsere Tage waren dunkel
Unsere Hemden waren schwarz
Wir standen ständig auf dem Schulhof in der Ecke und wir tauschten
Tief enttäuschte Blicke aus
Und immer wenn wir traurig waren
Und traurig waren wir ziemlich oft
Gingen wir zu dir nach Hause
Und da hörten wir die Smiths.“