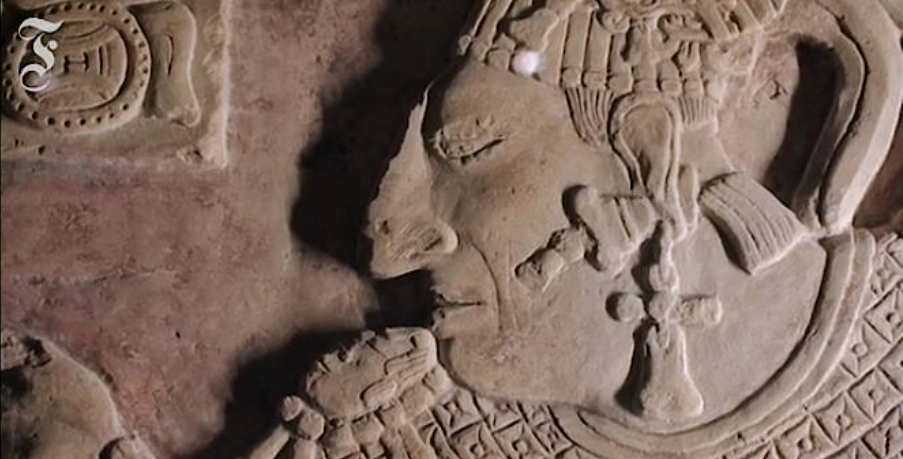So leicht Plagiate im Studium anzufertigen sind, so einfach kann man sie nachweisen. Gespräch mit einem Übeltäter und einem Germanistik-Dozenten, der sagt: Gedankendiebstahl verrät der Stil. Ghostwriting aber ist ein anderes Kaliber.
***

Ein Schamgefühl überkommt Dennis N.*, wenn er an die Anfänge seines Studiums zurückdenkt. Denn kurz nachdem er vor ungefähr fünf Jahren an die Universität ging, tat er genau das, was hochrangigen Politikern wie dem ehemaligen Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg gesellschaftliche Ächtung und Jahre in der politischen Bedeutungslosigkeit einbrachte: Er reichte ein Plagiat ein. Mit drei Freunden besuchte Dennis damals ein Seminar, in dem die Studierenden drei Essays einreichen mussten. Er ließ sich die Ausarbeitungen seiner Kommilitonen zukommen, schrieb sie um und gab die Arbeiten beim Dozenten ab. Eine eigenständige Denkleistung erbrachte er nicht, das weiß der Student selbst. Das bloße Umstrukturieren eines Textes ersetzt keine intensive Einarbeitung in ein Thema, der Erkenntnisgewinn dürfte sich in Grenzen gehalten haben. Jedoch ging er davon aus, damit durchzukommen und das Seminar zu bestehen. „Allerdings paraphrasierte ich die Essays nur so weit, dass noch erkennbar war, wer der eigentliche Autor ist“, weiß er einige Jahre später.
Als Dennis die Arbeiten seiner Freunde nur wenig verändert abgab, waren ihm die Konsequenzen seiner Tat weder bewusst, noch ging er davon aus, erwischt werden zu können. „Ich dachte, dass ich in der Masse untergehen und vielleicht nicht herausgegriffen werde“, sagt er heute. Panik machte sich erst breit, als er nur wenige Wochen nach der Abgabe eine ungehaltene E-Mail seines Dozenten bekam: Er solle sich umgehend bei ihm melden, es gebe etwas Wichtiges bezüglich seiner Arbeit zu besprechen. Da wusste Dennis sofort, worum es ging. Er erkundigte sich, und es wurde ihm klar: nicht nur das eigene Studium stand auf dem Spiel, sondern auch das seiner Freunde. Schließlich hätten sie genauso gut beschuldigt werden können, fremdes Gedankengut als das ihre verkauft zu haben. Dennis übernahm die Verantwortung für seine Taten, gestand dem Dozenten das Plagiat – und hoffte, dass er sein Studium fortsetzen werden könne.
Auf die Schwere des Vergehens kommt es an
Plagiieren ist kein kleiner Fauxpas, sondern eine Todsünde in der Welt des wissenschaftlichen Arbeitens – es ist nichts anderes als Diebstahl. Zitiert man aus einem fremden Text – vollkommen unabhängig, ob wörtlich oder bloß indirekt –, muss der Urheber kenntlich gemacht werden. Kommt ans Tageslicht, dass der Prüfling auf die Quellenangabe verzichtet hat, wird die Leistung im besten Fall als „nicht bestanden“ bewertet und das Institutsdirektorat in Kenntnis gesetzt, aber auch ein Rauswurf aus der Hochschule und Geldbußen bis zu 50.000 Euro sind möglich, erklärt Steffen Pappert, der an der Universität Duisburg-Essen in der Germanistik lehrt. „Es kommt auf die Art und die Schwere des Plagiats an“, sagt er. In der Regel müssen pfuschende Studierende die Prüfung einfach ein zweites Mal ablegen, von weitreichenderen Sanktionen wird eher selten Gebrauch gemacht.
Auch Dennis kam noch mal mit dem Schrecken davon: Sowohl von einer Exmatrikulation als auch von einer Geldbuße sah die Universität ab. Er musste lediglich das Seminar ein weiteres Mal besuchen und die Essays abermals schreiben – diesmal selbständig. „Ich bin froh, dass es so glimpflich ausging“, sagt Dennis. In der Reflexion seines Verhaltens beschreibt er es als „unklug“, sah damals aber keine andere Möglichkeit. „Zu diesem Zeitpunkt lag ich mit einigen Klausuren im Rückstand und hatte einen gewissen Zeitdruck im Nacken“, begründet er, warum er sich mit fremden Federn schmückte. Altlasten aus vergangenen Semestern, Seminare inklusive hunderter Seiten vorzubereitender Literatur und allgemein Schwierigkeiten, eigene Texte zu verfassen – das alles sei viel zu viel, um in der Regelstudienzeit das Studium zu absolvieren, findet er.
Reiner Zeitmangel sei aber insgesamt eher selten das Motiv studentischer Gedankendiebe, entgegnet Steffen Pappert. Vielmehr würden sie aus dem Irrglauben heraus täuschen, dass die Dozierenden die Arbeiten ohnehin nicht läsen. Davon abgesehen seien Plagiate Einzelfälle, die „sehr, sehr selten“ vorkämen. Am häufigsten fänden sich in Hausarbeiten Passagen aus Wikipedia-Texten, und „die etwas geistreicheren Studierenden nehmen Texte aus einschlägigen Portalen“, führt Pappert aus. Internetseiten wie Grin.com und Hausarbeiten.de bieten abertausende Haus- und Abschlussarbeiten an – teils gegen Bezahlung, teils kostenfrei. In der Regel stechen die geklauten Passagen sofort ins Auge: Der Stil unterscheide sich oft vom restlichen Text und es mangele an Kohärenz, so Pappert. Man komme schnell dahinter, ob es sich um die Arbeit des Studierenden selbst handele. So einfach es sich die vermeintlichen Verfasser mit der Tastenkombination Copy and Paste gemacht haben, so einfach könne man sie auch auffliegen lassen – Google macht’s möglich. Die Dozierenden müssten lediglich nach der fraglichen Textstelle suchen und könnten so ein Plagiat schnell nachweisen.
Ghostwriter sorgen für Schwierigkeiten
Schwierig wird es jedoch, wenn Studierende ihr Kapital für sich arbeiten lassen: Der Markt für Ghostwriter floriert, immer mehr Agenturen etablieren sich und kassieren von zahlungswilligen Studierenden bis zu fünfstellige Summen fürs Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten. Allein die Ghostwriting-Agentur Acad-Write schrieb im Jahr 2015 zweihundert Haus- und Abschlussarbeiten für ihre Klienten. Legt man genug Geld auf den Tisch, gehen solche Agenturen äußerst professionell vor. Sie recherchieren die fachlichen Hintergründe und schicken ihre Kunden sogar mit einem Fragenkatalog in die Sprechstunde ihrer Dozenten. Denn vollkommene thematische Ahnungslosigkeit können sich die Studierenden natürlich nicht leisten. Die in den Sprechstunden gewonnenen Informationen helfen dem Ghostwriter dann wiederum beim Verfassen der Hausarbeit. „Wenn Ghostwriter sich an Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens halten, ist es schwer, ein Plagiat nachzuweisen“, sagt Pappert. Schließlich findet man diese Arbeiten nicht in den Weiten des Internets wieder – es handelt sich ja um exklusiv verfasste Texte. An dieser Stelle sei das Gespür der Lehrenden gefragt: In Sprechstunden merke man schon, ob die Studierenden von der Materie ihres Hausarbeitsthemas profunde Kenntnis hätten, meint Pappert. Ob das immer gelingt, bleibt fraglich. Nicht alle Studierenden, die exzellente Hausarbeiten schreiben, können ihr Gedanken auch in der mündlichen Kommunikation in vergleichbarer Weise vorbringen.
An der gesamten Universität Duisburg-Essen bewege sich die Zahl der angezeigten Plagiate im niedrigen einstelligen Bereich, so die Pressestelle. Die Dunkelziffer dürfte aber wohl höher liegen. Innerhalb der Studierendenschaft werde über das Thema Plagiate relativ offen gesprochen, sagt Dennis. Wenn man sich mit Kommilitonen unterhalte, höre man des Öfteren von Hausarbeiten, die seit Jahren an der Universität herumgeistern und in etwas abgeänderter Form immer wieder eingereicht würden. Pappert hat dafür kein Verständnis: „Wir bereiten Studierende sehr intensiv auf wissenschaftliches Arbeiten vor“; in den ersten Semestern müssten Studierende Seminare zu wissenschaftlichem Arbeiten besuchen, Zitationsregeln pauken und Literaturrecherche lernen. Zusätzliche freiwillige Angebote wie die Schreibwerkstatt würden sie unterstützen, gute Hausarbeiten zu schreiben und wissenschaftliche Methoden korrekt anzuwenden. Allerdings scheinen diese nicht bei allen Studierenden anzukommen. „Bis zu meiner Bachelorarbeit, vier Jahre nach Studienbeginn, wusste ich eigentlich gar nicht, wie man wissenschaftlich sauber arbeitet. Vorher war es eher pseudowissenschaftliches Geplänkel“, sagt Dennis über seine ersten Gehversuche auf dem Weg zum akademischen Grad.
Eine bessere Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten sei wichtig, findet auch Dennis. Aber dass allein dadurch die Zahl der Plagiate sinken würde, bezweifelt er – auch vor dem Hintergrund seiner eigenen Geschichte. „Ich glaube, es gibt immer einen Teil von Studierenden, die versuchen, mit wenig Arbeit durchs Studium zu kommen. Die wird man sicher auch damit nicht erreichen“, meint er pessimistisch. Manche müssten am eigenen Leib spüren, wohin geistiger Diebstahl führt. Denn seitdem Dennis vor dem Abgrund der Exmatrikulation stand und um seine Zukunft bangte, bemüht er lieber eigene Denkkraft.
* Name geändert