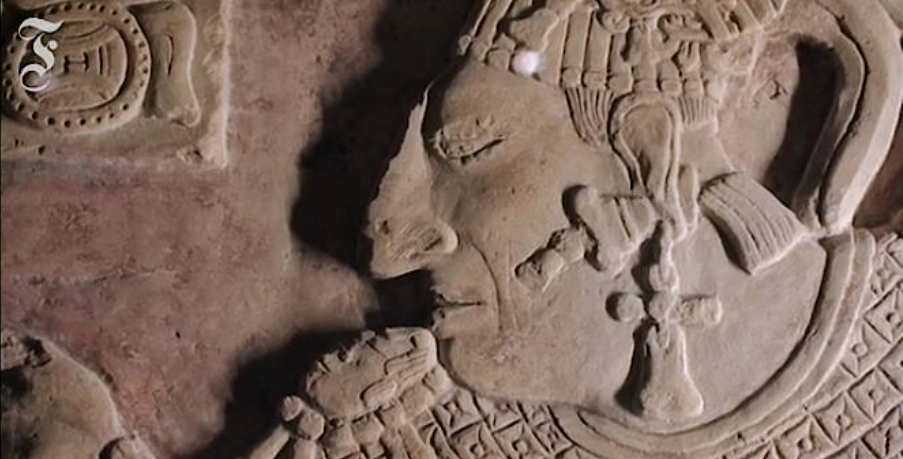Die Debatte um den offenen Brief “Zur Verteidigung der Präsenzlehre” hat sich in Nebensächlichkeiten verhakt. Aus studentischer Sicht drücken sich die Beteiligten um Kernfragen ihrer Disziplin im digitalen Zeitalter.
***

Das erste digitale Semester war noch nicht offiziell beendet, da häuften sich in den Medien bereits erste Erfahrungsberichte, Resümees und Zukunftsprognosen: Ein Gastbeitrag in der ZEIT sah in den technischen Umwälzungen der Corona-Krise zuletzt die „einmalige Chance, die Hochschullehre zu revolutionieren.“ Ähnlich forderte der Soziologe Christian Dries in seiner „Abrechnung mit einem teilweise überholten System“ (SZ) ein Ende des „Digitalgejammers“ – mit der Umsetzung des blended learning, der Kombination analoger und digitaler Lehrmethoden, gelte es endlich, „Ernst zu machen“. Kritisch abgesetzt wurde sich dabei – teils nicht ohne eine gewisse Häme – von dem offenen Brief „Zur Verteidigung der Präsenzlehre“. Dieser kursierte seit Anfang Juni in akademischen Kreisen und wurde von einigen ProfessorInnen der Germanistik verfasst.
Zwar erhielt das Plädoyer für die Universität als gemeinsamer Lebens- und Lernraum breiten Zuspruch, die von ihm beschworene Gefahr einer institutionellen Abkehr von der Präsenzlehre mochten aber nicht alle erkennen: Vielmehr handle es sich, so der Soziologe Armin Nassehi, um „eine gratismutige Verteidigung von etwas, das niemand in Frage stellt.“ Auch die Bonner Professorin für Neuere Deutsche Literatur, Kerstin Stüssel, attestierte dem Schreiben unlängst einen Mangel „an Fairness, an historischem Bewusstsein und an Gegenwartskenntnis“.
In der anhaltenden Diskussion um den Brief ist immer wieder bemerkt worden, dass dieser vor allem innerhalb der geisteswissenschaftlichen Disziplinen Rückhalt und Unterstützung gefunden hat. Konsequent hinterfragt wurde das nie. Offenbar wurde stillschweigend hingenommen, dass sich die Naturwissenschaften, deren Forschung von der Datenerfassung bis hin zur Publikation durchdrungen ist von digitalem Optimismus, mit der Adaption digitaler Lehrmethodik leichter tun. Diesem naiven Dualismus nach herrscht unter den bücherstöbernden und rückwärtsgewandten Geisteswissenschaftlern das größere Unbehagen vor dem Sprung ins Digitale.
Die viel interessante Frage ist doch: Worum geht es dann eigentlich?
Nun möchte man diesem alten Klischee – demjenigen der Zwei Kulturen von C. P. Snow – nur allzu gern widersprechen: Dafür genüge ein Hinweis auf den beachtlichen Aufwand, mit dem unter den Schlagwörtern Digital Humanities und Open Access in jüngerer Zeit Bibliotheken und Bildbestände digitalisiert, antike und mittelalterliche Handschriften frei zugänglich gemacht und algorithmusbasierte Untersuchungen (durch sogenanntes Text Mining) ermöglicht wurden – dem Exotenstatus der Computerphilologie zum Trotz.
Die Geschichte geisteswissenschaftlicher Aneignung digitaler Infrastruktur – die von Roberto Busas Index Thomasticus von 1949 bis hin zu Googles Ngram Viewer reicht – schafft auch in der Lehre neue Selbstverständlichkeiten: Gemeinsame Textanalyse funktioniere, erklärt Kerstin Stüssel, eben „nicht nur mit Reclam-Heften, sondern auch über freigeschaltete Bildschirme und Scans.“ Entsprechend verzeichnet eine jüngere Umfrage des Philosophischen Fakultätentages eine überraschend positive Aufnahme des virtuellen Semesters unter den Studierenden.
Darf man jene Warnrufe einiger GeisteswissenschaftlerInnen daher als reine Phantomschmerzen abtun? Als Überreaktion eines verkappten Kulturpessimismus? Denn offenbar wird weder die Unerlässlichkeit sozialen Miteinanders für die Hochschuldidaktik ernsthaft in Frage gestellt, noch stehen sich herkömmliche und digitale Methodik unvereinbar gegenüber. Die viel interessante Frage ist daher: Worum geht es dann eigentlich? Das heißt: An welche tieferen Sorgen und Bedürfnissen rührt der offene Brief, die ihm zu einer so zahlreichen Unterstützung verholfen haben? Es scheint, als ginge es um mehr als den Ärger über verwackelte Videokonferenzen und seitenweises Einscannen von Lehrmaterial. Als dränge sich in der gegenwärtigen Krise vielmehr die Ungewissheit über Formen und Methoden geisteswissenschaftlicher Tätigkeit in einer digitalen Zukunft im Allgemeinen auf.
Gefahr der „Geschichtslosigkeit“
Bestenfalls betrifft diese Ungewissheit mehr die Frage nach dem „Wo und Wie“ statt jene nach dem „Ob“: So postulierte bereits 1986 der Philosoph Odo Marquard die Unentbehrlichkeit der Geisteswissenschaften in einer immer modernisierten Welt. Diese sei durch ihre genuine Fähigkeit begründet, Modernisierungsschäden, welche durch die Geschwindigkeit naturwissenschaftlicher und technischer Innovationen entstünden, zu kompensieren. Marquard schloss damit an die Ideen seines Lehrers Joachim Ritter an, wonach die Geisteswissenschaften zwangsläufig die ehemalige Rolle der Philosophie und Metaphysik einnähmen, um dem „geschichtslosen“ Individuum der Moderne die „Summe der Erfahrungen, die der Mensch mit sich und der Welt gemacht hat“ zu vergegenwärtigen. Jene Tendenz zur Geschichtslosigkeit sah Ritter erstmals zur Zeit der Industrialisierung – als „Sitte, Brauch, Tracht, Gerät, Kunstwerke, ehrwürdige geschichtliche Bauten ohne Bedenken den Bedürfnissen der Gesellschaft geopfert“ wurden – verwirklicht. Der daraufhin erwachte „historische Sinn“ antworte seither auf die durch die Allmacht des technischen Fortschritts beförderte Herkunftslosigkeit und Entfremdung des Menschen.
Natürlich kann man ein solches Verständnis der Geisteswissenschaften für antiquiert halten. Und doch lässt sich die tiefe Verankerung des Traditions- und Geschichtsbewusstseins, sei es nur als Skeptizismus gegenüber einem „Absolutismus der Gegenwart“ (nach Hans Blumenberg 1975) verstanden, in den Geisteswissenschaften kaum verleugnen. So erhofft sich ein Philologe nicht selten, die zeitlose Poesie eines alten, noch unbeachteten, schwer zugänglichen Stück Textes freizulegen; so kann sich ein Philosoph heutzutage problemlos als Hegelianer bezeichnen; und so gilt manchem Historiker die antike Geschichtsschreibung nur unter modernen Maßstäben als unzuverlässig und falsch.
Jener traditionellen Vorstellung geisteswissenschaftlicher Tätigkeit, wie sie noch in der Morgendämmerung der digitalen Revolution theorisiert wurde, und noch immer lebendig ist, begegnet in dem digitalen Medium ein ungleiches Gegenüber: Wurde in der Lebenswelt mühsam daran gearbeitet, durch die Autorität leinenbezogener Buchdeckel, die Stille in den Bibliotheken, die weißen Wände in den Museen, oder die Dunkelheit in den Theatersälen, das Erinnerungswürdige, Bedeutungsvolle von dem Vergänglichen und Banalen zu trennen, zerfließt im digitalem Raum alles in einem niemals ruhenden, egalisierenden Fluss. Strebt der geisteswissenschaftliche Verstand diesseits nach historischem Abstand, nach Kontemplation und Exklusivität, findet er jenseits den Primat der Aktualität und Interaktivität vor. Dort liegt das Vergangene hinter aufgeräumten Benutzeroberflächen verborgen, und wird je nach Schlüsselwortsuche passend offeriert, die individuelle Entdeckung auf den Umwegen des Nicht-Einschlägigen entfällt zumeist. Auch dies kann als Gefahr der „Geschichtslosigkeit“ verstanden werden.
Die Debatte darf nicht bei Nebensächlichkeiten stehen bleiben
Man kann diese Unversöhnlichkeit mit guten Gründen anzweifeln und sie für das Ergebnis einer überkommenen, romantisierten Vorstellung von geisteswissenschaftlicher Arbeit halten – dennoch weist die Resilienz des „Kompensationsgedankens“ einerseits und das Klischee der unzeitgemäßen ProfessorInnen andererseits noch auf etwas anderes hin: nämlich darauf, dass der Brief „Zur Verteidigung der Präsenzlehre“ nur das oberflächliche Anzeichen einer tiefergehenden, akademischen Krise darstellt – vor der letztlich auch die Naturwissenschaften nicht gefeit sind.
So geht es eben nicht nur darum, dass gemeinsame Textanalyse „auch über freigeschaltete Bildschirme und Scans“ funktioniert, sondern um die Frage, wie dies den hermeneutischen Zugang zu Texten, ihrem Informationsgehalt, ihrer Poesie, mithin auch die Gesichtspunkte ihrer Auswahl verändert. Wie sich Textanalysen umgekehrt durch ihre Digitalisierung zum „diskursiven Objekt verwandeln, in ein Produkt additiver Interventionen verschiedener Autoren“ (Koller 2016). Nicht zuletzt auch, durch wen die besagten Bildschirme und Scans freigeschaltet werden – und ob dabei Neutralität gewahrt bleibt. Es sind (noch) vakante Antworten auf Fragen wie diese, an die der Brief zur „Verteidigung der Präsenzlehre“ erinnert.
Indem Fragen wie diese vehement verschwiegen werden, lenkt die Diskussion von der Dringlichkeit ab, mit der es die Identität, Funktion und Methodik der Geisteswissenschaften im digitalen Zeitalter neu zu vergegenwärtigen gilt – an die Notwendigkeit der Entwicklung einer digitalen Hermeneutik, einer digitalen Epistemologie, einer digitalen Quellen- und Datenkritik. Die Debatte darf daher nicht weiter um Formalitäten der Lehre kreisen – denn wie sollen Lehrende eine digitale Arbeitspraxis überhaupt vermitteln, zu der sie bislang selbst kein aufgeklärtes Verhältnis gewinnen konnten?
Sekundärliteratur
Joachim Ritter, Die Aufgabe der Geisteswissenschaften in der modernen Gesellschaft, 1963
Odo Marquard, Über die Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften, 1986
Hans Blumenberg, Die Genesis der kopernikanischen Welt, 1975
Guido Koller, Geschichte digital: Historische Welten neu vermessen, 2016