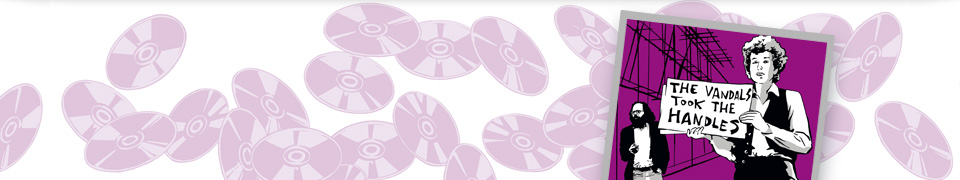Manchmal können Songs auch ohne Worte auskommen, um Geschichten zu erzählen: Brian Enos berühmtestes Instrumentalalbum von 1978 zeigt die einzigartige Kraft der Popmusik, die Empfänger zu Produzenten zu machen.
***
 Brian Eno
Brian Eno
Es gibt eine wunderschöne Szene in „Alles in Butter“, dem autobiographischen Roman des Fernsehjournalisten Dieter Zimmer über seine Jugend nach dem Krieg: Da sitzen zwei Freunde ratlos um eine Schallplatte herum, es ist 1956 in Hannover und die beiden Jungs wissen noch nicht, dass sie bald Teenager sein werden. Genauso wenig wissen sie, dass diese Platte in ihren Händen einen großen Beitrag dazu leisten wird. Um das zu verstehen, müssten sie nämlich erst mal verstehen, worum es auf dieser Platte eigentlich geht. Aber ihr Schulenglisch hilft nicht weiter: Sie scheitern schon am Titel. „Felsen um die Uhr“, schlägt der eine der beiden vor, und da diese Platte aus dem Wunderland Amerika kommt – und wer weiß schon, wie’s da genau zugeht –, entscheiden sich die Jungs, dass es damit wohl seine Richtigkeit haben wird.
„Felsen um die Uhr“, ein Welthit von Bill Haley.
Aber muss man eigentlich wissen, dass „Rock around the clock“ in Wirklichkeit davon handelt, dass wir rund um die Uhr rocken werden, heute Nacht – wenn der Song einem das von der ersten Sekunde an auch ohne Worte, aber mit jeder Note erklärt? Wozu überhaupt Text, Sinn, Poesie im Pop, wenn es so dermaßen abgeht (wie bei Bill Haley), dass man eh nur mitbrüllen und die Hände in die Luft werfen will? Umgekehrt muss man auch keine Zeile von Morrisseys „Everyday is like Sunday“ verstehen, um in eine ausgewachsene Sonntagsnachmittagsdepression zu stürzen, das ganze Moll reicht schon.
Früher, vor dem Internet und seiner Schwarmintelligenz, konnte man ziemlich sauer werden, wenn Schallplatten keine Songtexte beilagen. Diese Frustration, wenn man das Vinyl aus der Hülle zog und es in schlichtem Weiß steckte! Oder, noch schlimmer, in bedeutungsschwanger arrangierten Bandfotos! Da saß man dann, mit den Kopfhörern auf den Ohren, und reimte sich zusammen, was man hörte – und je jünger und je geringere Englischkenntnisse, desto felsenumdieuhriger wurde es.
Inzwischen sind Missverständnisse und Verhörer in der Popmusik zu einer eigenen Gattung geworden. Axel Hacke hat sogar einen Bestseller daraus gemacht. Weil es einfach lustig ist, wenn man nicht genau versteht, was da gesungen wird und es sich selbst zurechtlegt. „Stille Nacht, Heilige Nacht, Gottes Sohn Owi lacht“ – es muss nicht mal auf Englisch sein. Und es sortiert sich wie von selbst und bringt einen neuen Sinn hervor. Der amerikanische Showmaster Jimmy Fallon hat einmal sein Publikum gebeten, ihm Lieblingsverhörer zu schicken: Eine Frau verstand beim Refrain von „Start me up“ der Rolling Stones immer „In Yugoslavia you’ll never starve“, und wer jetzt lacht, soll das einfach mal singen oder sich auf Youtube angucken, wie Fallon es tut – oder darüber nachdenken, wie satt man von Cevapcici wird.
Aber solche Verhörer belegen auch eine elementare Wahrheit über die Popmusik: Das Publikum trägt schöpferisch zur Vervollständigung des Kunstwerks „Popsong“ bei. Und das geht weit über lustige Verhörer hinaus. Es sind die Wachträume und Melodramen, die sich wie von selbst einstellen. Es sind die Bilder, die man sich im Kopf macht, während man im Zug sitzt und zu Lieblingsliedern aus dem Fenster starrt. Oder man sitzt zuhause vor der Stereoanlage und starrt auf das Cover. Oder das Display. Oder schließt die Augen. Vor dem ersten Kuss zum Beispiel denkt man sehr oft bei Musik an den ersten Kuss.
Und es ist auch die Kultursendung im Fernsehen, die einen Beitrag über Seiltänzer oder impressionistische Landschaftsmalerei bringt und dazu immer Eric Satie spielt. Alle Kultursendungen zu allen Zeiten haben das so lange getan, bis man derartig konditioniert war, dass man schon von selbst Seerosen sieht, wenn irgendwo „Gymnopédie No. 1“ läuft. Satie kann überhaupt nichts dafür. Aber er wird das auch nicht mehr los. Die Leute, die ihn hören, haben das gemacht, und manche davon dachten, dass er Seiltänzermusik komponiert haben könnte, und jetzt ist sie das.
Der Empfänger ist die Botschaft
In seinem Buch „Über Popmusik“ hat der Kulturwissenschaftler Diedrich Diederichsen den Empfängern eine, wenn nicht die entscheidende Rolle im Pop zugeordnet. Sie nehmen die Sache in die Hand. Sie reißen das, was vom Sender kommt, aus dem Zusammenhang. Und ordnen es neu nach eigenen Bedürfnissen. Und stiften Sinn. Das fällt leichter, wenn es Texte gibt, an denen sich diese Sinnstifung entzünden kann – aber damit ist noch nichts über den Wahrheitsgehalt gesagt.
Der lässt sich ohnehin nicht bestimmen. „Die Diktatur der Angepassten“, heißt ein alter Song der Band Blumfeld, „das Geld vibriert und auf den Genchips / diktiert ein freier Markt das Leben“, singt Jochen Distelmeyer darin – trotzdem ist der Song als Hymne für neoliberalen Nonkonformismus verstanden worden. Man könnte sagen, dass sich das verbietet, wo Distelmeyer hier doch den freien Markt offenbar verdächtig findet – aber noch mehr verbietet es sich, Botschaften vorzuschreiben oder festzulegen. Ein paar sind klarer als andere heraushörbar. Aber gerade Slogans sind manipulierbar.
Der englische Popkünstler Brian Eno hat im Jahr 1978 eine Schallplatte ganz ohne Worte aufgenommen, „Music for Airports“. Nicht sein einziges reines Instrumentalwerk, aber dafür das berühmteste. Eno hatte irgendwann auf dem Flughafen Köln/Bonn am Gate gewartet: Die Musik, die dort lief, plagte ihn mit ihrer vulgären guten Laune so sehr, dass er später vier Stücke komponierte, die, wie Eno einmal erklärte, das Gefühl vermitteln sollten, „als wäre man im Universum aufgehoben, als wären Leben und Tod nicht so wichtig.“ Robert Wyatts Klaviertöne auf dem ersten der vier Stücke, „1/1“, schweben wie die von Eric Satie – und legen sich über alles, was man dazu tut oder sieht. Verwandeln es sich an, machen es sich zu eigen. Es funktioniert sogar als Soundtrack zu Videospiel-Skirennen, ich habe es ausprobiert.
Eno, ein Theoretiker der Popmusik, arbeitete damals am Konzept einer Umgebungsmusik, die sich auflöst im Ambiente. Die man aufnimmt, ohne es zu merken. Musik, die man nicht hört. In der man nichts hört – oder alles. „Music for Airports“ kommt ohne Worte aus. Aber erzeugt so viele, dass man sie nicht mehr zählen kann. Vielleicht handeln sie sogar von Flughäfen.