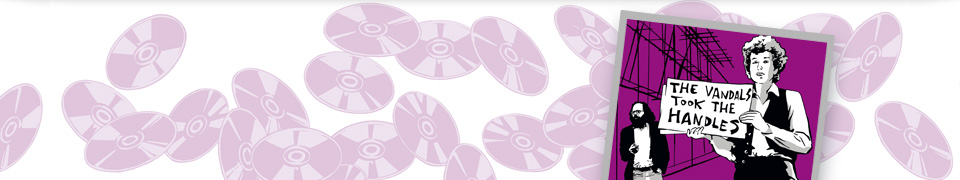John Prine schrieb Küchentischlieder über das unsaubere amerikanische Leben. Sein Song „Sam Stone“ erzählt von den Wundmalen eines drogenabhängigen Veteranen – und verkündet eine trostlose Osterbotschaft, die Johnny Cash nicht über die Lippen kam.
***

Sam Stone ist kaputt. Granatsplitter im Knie, Bilder im Kopf. Im Hintergrund rotiert eine Jahrmarkt-Orgel wie ein leeres Karussell, dann singt John Prine den nasalen Euphemismus, der die Tragik des Liedes schon in sich trägt: Sam Stone came home / To his wife and family / After serving in the conflict overseas. Was genau Sam Stone widerfahren ist, was er getan hat und ihm angetan wurde, wird nicht ausgesprochen. Niemand fragt. Sam Stone war nicht im Krieg, er hat gedient. Doch Zeit und Feind haben ihm die Nerven zerbombt. Er kehrt als Wrack zurück zu Frau und Familie. Uncle Sam, sein Namenspatron, dekoriert ihn mit dem Verwundetenorden Purple Heart – und vergisst ihn.
„Sam Stone“ ist, was John Prine am besten konnte: Küchentischmusik über unsaubere amerikanische Leben. Am vergangenen Dienstag ist das seine nach 73 Jahren, in denen er unter anderem schlechter Schüler, mittelmäßiger Briefträger, widerwilliger Soldat und hervorragender Musiker war, zu Ende gegangen. Es bleiben unvergessliche Lieder von „Sweet Revenge“ bis „Lake Marie“, die ernst sind, ohne ernsthaft zu sein. Texte, die einen zum Lachen bringen, ohne dass man froh ist oder einem die Tränen in die Augen treiben, ohne dass man die Hoffnung verliert. Dieser Song, der 1971 auf John Prines Debütalbum erschien, gehört in beide Kategorien.
Sam Stone. Came home. Der Humor, der viele von Prines traurigsten Liedern auszeichnet, beginnt in der Vortragsweise: vier Einsilber und ein Binnenreim als Miniaturexposition, zwar kein Limerick, aber sein amerikanischer Cousin. Bis zu seinem Tod war Prine ein treuer Leser der Comicserie „Archie“. Sam Stone ist selbst eine Art Comicfigur. Wir sehen zwei Paneele: Auf dem ersten kommt Sam nach Hause. Auf dem zweiten schlürft seine Seele Morphium.
In welch schwere Dunkelmetaphorik man sich auch stürzen könnte, um den Kampf des Junkies gegen seine Dämonen zu beschreiben – Prine tut es nicht. Stattdessen greift er in trockener Mittelwest-Manier zu einem possierlichen Countryismus: a monkey on his back. Ein Äffchen, das keine Bananen frisst. Wir wissen es, sobald der Refrain erklingt, dessen ersten beiden Zeilen zu den berühmtesten der Country-Geschichte gehören.
There’s a hole in daddy’s arm where all the money goes
Jesus Christ died for nothin’, I suppose
Wie viel Ungesagtes steckt in diesem Reim, wie viel Fatalismus in seiner Beiläufigkeit? Als Johnny Cash „Sam Stone“ coverte, kam dem frommen Christen der zweite Vers nicht über die Lippen. Auf dem 1987 aufgenommenen Album „Live in Austin, TX“ singt Cash: Daddy must have hurt a lot back then, I suppose. Das ist wahr und doch zu wenig. Bei Cash hat Vater Schmerzen, bei Prine ist Jesus umsonst gestorben. Es ist dieser resignierte, scheinbar gleichgültige Satz, der Sam Stones Leben zum ewigen Karsamstag macht. Das Loch im Arm ist sein Wundmal.
Jede funktionale Sprache scheitert hier. Das Leiden dieser Figur, die für so viele ehemalige Militärangehörige steht, weiß sie lediglich als „posttraumatische Belastungsstörung“ zu beschreiben. Die medizinische Diagnose klingt nach Klemmbrett, Prines poetische nach Verzweiflung.
Sie trifft einen so hart und verständlich, weil der Refrain beinahe unbemerkt einen Perspektivwechsel vornimmt. Gerade sprach noch ein unbeteiligter Erzähler. Jetzt – Daddy? – hören wir Sams eigene Kinder. Und Kinder, sagen sie, bekommen mehr mit, als man denkt.
Little pitchers have big ears
Don’t stop to count the years
Sweet songs never last too long on broken radios
Die Zeit verstreicht. Bald ist Sam Stone kein heroischer Rückkehrer mehr, sondern ein unsichtbar versehrter Bürger. Er versucht, ein normales Leben zu führen. Er geht zur Arbeit. Irgendwann wird er sich mithilfe der G.I. Bill, Amerikas Subventionsprogramm für Veteranen, ein Haus kaufen. Doch es reicht nicht. Das Loch ist zu tief. Lohnarbeit und Staatshilfe können keinen hundred-dollar habit nebst Familie ernähren. Nicht umsonst fällt der erste Moll-Akkord des Songs auf das Wort money: Es fehlt. Sammy took to stealing / When he got that empty feeling.
Über den Mann selbst erfährt man in „Sam Stone“ überraschend wenig. Was er sieht, was er liebt, was er hofft, wird von der Drogensucht übertüncht. Sie lässt selbst die Familie zur Seite fallen, wie die zweite Strophe in einem bitteren Postskriptum wissen lässt. John Prines musikalisches Alphabet war pure country, in einem späten Interview scherzte er, dass oberhalb des dritten Gitarrenbundes für ihn alles Neuland sei. Auch in „Sam Stone“ betritt er es nicht. Er verlässt sich auf offene Akkorde und Country-Kadenzen. Nach deren Spielregeln aber müssten die Strophen allesamt eine Zeile eher enden. Prine singt ausgiebig über die gloriose Taubheit, die Sam aus der Spritze zieht…
And the gold rolled through his veins
Like a thousand railroad trains
And eased his mind in the hours that he chose
…und hängt, nachdem er mit zwei Dominantakkorden vermeintlich schon den Refrain eingeleitet hat, noch ein nachrangiges Addendum an: while the kids ran around wearin’ other people’s clothes. Die Kinder rennen in Secondhand-Klamotten rum. Wenn dann der Refrain folgt, kann man sich der Vorstellung nicht erwehren, wie Sams Kinder fröhlich im Kreis herumlaufen und ihre Familienversion von „Hoppe, hoppe, Reiter“ singen: There’s a hole in daddy’s arm—.
Sam Stone stirbt. An einer Überdosis. Niemand singt mehr, er ist allein. Begraben wird er auf einem jener amerikanischen Militärfriedhöfe, auf denen Menschen selbst im Tod uniformiert sind. Auf seinen Sarg legt man ein rotweißblaues Leichentuch.
But life had lost its fun
And there was nothing to be done
But trade his house that he bought on the G. I. Bill
For a flag-draped casket on a local heroes’ hill
John Prine war kein Patriot der eifernden Sorte. Er schrieb Sam Stone nicht in den Himmel, sondern in den Boden – aus Ehrlichkeit, nicht aus Verachtung. Er, der als junger Mann das Glück hatte, vom Militär statt nach Vietnam nach Schwaben abkommandiert zu werden, wusste, dass keine Flagge der Welt einem Einlass ins Paradies verschafft. Your flag decal won’t get you into heaven anymore, singt er auf seinem Debütalbum ein paar Songs nach „Sam Stone“. Davor, in „Hello in There“, heißt es: We lost Davy in the Korean War / And I still don’t know what for / Don’t matter anymore.
Nach seinem Militärdienst war Prine in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt und hatte gesehen, was der Vietnamkrieg seiner Generation antat. Sterben ist zwecklos, fand er, ob in Korea, Vietnam, Jerusalem oder zu Hause im Sessel. Sam Stone ist kein Märtyrer, auch wenn das leichter zu akzeptieren wäre. Er ist ein Kriegstoter auf heimischem Boden. Der conflict overseas war, wie Tausende alleingelassene Sam Stones feststellen mussten, auch ein conflict within.
Mit John Prine ist ein großer amerikanischer Geschichtenerzähler und Sprachspieler gestorben. Sein Sujet war, wie er in einem späteren Song sang, the scientific nature of the ordinary man. Sam Stone war ein solcher und John Prine sein aufrichtiger Erforscher.
***
„Sam Stone“
Sam Stone came home
To his wife and family
After serving in the conflict overseas
And the time that he served
Had shattered all his nerves
And left a little shrapnel in his knee
But the morphine eased the pain
And the grass grew round his brain
And gave him all the confidence he lacked
With a Purple Heart and a monkey on his back
There’s a hole in daddy’s arm where all the money goes
Jesus Christ died for nothin’, I suppose
Little pitchers have big ears
Don’t stop to count the years
Sweet songs never last too long on broken radios
Sam Stone’s welcome home
Didn’t last too long
He went to work when he’d spent his last dime
And Sammy took to stealing
When he got that empty feeling
For a hundred-dollar habit without overtime
And the gold rolled through his veins
Like a thousand railroad trains
And eased his mind in the hours that he chose
While the kids ran around wearin’ other people’s clothes
There’s a hole in daddy’s arm where all the money goes
Jesus Christ died for nothin’, I suppose
Little pitchers have big ears
Don’t stop to count the years
Sweet songs never last too long on broken radios
Sam Stone was alone
When he popped his last balloon
Climbing walls while sitting in a chair
Well, he played his last request
While the room smelled just like death
With an overdose hovering in the air
But life had lost its fun
And there was nothing to be done
But trade his house that he bought on the G. I. Bill
For a flag-draped casket on a local heroes’ hill
There’s a hole in daddy’s arm where all the money goes
Jesus Christ died for nothin’ I suppose
Little pitchers have big ears
Don’t stop to count the years
Sweet songs never last too long on broken radios