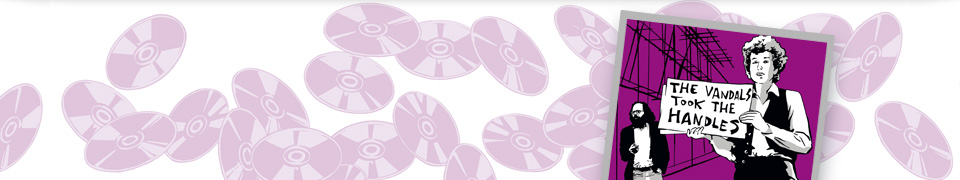Nicht nur die CSU verkennt, dass Hans Söllner Deutschlands mit Abstand bester Hofnarr ist. In diesem Song kehrt er die Besitzverhältnisse um – ein Augenöffner mit Zukunftspotential.
***

Viel zu selten überrumpelt einen die Pop-Musik mit einer Weltanschauung, die nicht nur abweicht, sondern auch wirklich nachdenklich macht – und zwar derart, dass man einem Song lachend einfach zuzustimmen muss. Es ist natürlich Geschmacksache, aber „A Jeda“ von Hans Söllner aus dem Jahr 1997 ist solch ein Gedankenlüfter. Wie kommt ein Musiker dazu, ein derart freigeistiges und lustiges Lied zu schreiben? Es ist aufschlussreich, Söllners Entwicklung bis zu diesem Song zu verfolgen.
An die Öffentlichkeit tritt der am Heiligen Abend des Jahres 1955 in Bad Reichenhall geborenen Hans Söllner erstmals mit der Platte „Endlich eine Arbeit“. Und die Hauptthemen seines Lebenswerks, zunächst noch etwas schüchtern, aber umso trotziger vorgetragen, sind schon 1983 da: Fundamentalopposition gegen den Staat, grober, allerdings erkennbar rollenhafter Hass auf Politiker, Politessen und Polizisten aller Art. Mühelos sind in Interviews und den frühen Liedern die Ursprünge von Söllners Staatsverachtung erkennbar. Vor allem das deprimierende Erlebnis von Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit haben den ausgebildeten Koch und Kfz-Mechaniker geprägt. Wobei Arbeit, was die Sache nicht leichter macht, aus Söllners Sicht sinnvoll und erfüllend sein muss. Wollte man den Titelsong von „Endlich eine Arbeit“ auf den Punkt bringen, wäre es wohl dieser: Lohnerwerb in seiner verbreiteten Form ist unerträglich, es sei denn der Chef ist ein Punk.
Gesellschaftlichen Ausschluss muss Söllner, der sich in seiner alpinen Heimat schon früh die Haare wachsen ließ, im Trachtenverein und anderswo zuhauf erlebt haben, dieses Motiv zieht sich wie ein roter Faden durch seine Lieder. Geschont wird auch die „eigene Familie“ nicht, deren gesellschaftlicher Anpassung Söllner auf seiner ersten Platte den Song „Mei Vadda“ gegenüberstellt – die utopische Geschichte von einem Altvorderen, der den „Marihuanabaum“ für sich entdeckt, hinfort den Garten und das Leben laufen lässt und, aus Sicht des Sängers, „wieder ganz normal“ wird. Es ist bemerkenswert, mit welcher Konsequenz Söllner im Lauf seiner Karriere die gemäßigte Marihuanainhalation gegen alle gesellschaftlichen Widerstände und selbst vor Gericht als vernünftigste Form des Weltertragens darstellt.
Beschäftigt man sich eingehender mit Söllners Werk, wird hinter all den Invektiven und Provokationen schnell ein enttäuschter Gesellschaftsromantiker erkennbar, einer, der seine höchsten moralischen Ansprüche und Freiheitsforderungen so zu formulieren versucht, dass man auch darüber lachen kann. Damit erinnert Söllner an einen fahrenden Sänger, mehr noch einen Hofnarren – jenes gesellschaftliche Korrektiv also, das Ralf Dahrendorf einmal in einem „Zeit“-Essay von 1963 als vorbildlich für den modernen Intellektuellen dargestellt hat: „Sie alle, die Intellektuellen, haben als die Hofnarren der modernen Gesellschaft geradezu die Pflicht, alles Unbezweifelte anzuzweifeln, über alles Selbstverständliche zu erstaunen, alle Autorität kritisch zu relativieren, alle jene Fragen zu stellen, die sonst niemand zu stellen wagt.“
Söllner ein Intellektueller? Diese These mag für viele gewöhnungsbedürftig klingen. Zumal Söllners Ansichten, wenn es um Politiker und Polizisten geht, zunächst nicht von Stammtischparolen zu unterscheiden sind. Beamtete Spießer treiben den erklärten Pazifisten in seinen Liedern zu teilweise irritierenden Gewalt- und Selbstjustizphantasien, die freilich eine lange Tradition in der populären Musik und nicht zuletzt auch in der alpinen Volksmusik (Gstanzl) haben. Politiker reden, wie Söllner in unzähligen Liedern singt, nur unverständliches Zeug, sie lügen und denken nur an sich selbst, insgesamt seien sie „saudumm“. Wobei sich Söllners Beleidigungen, und hierin wird seine radikal-anarchistische Sicht auf Machtstrukturen aller Art deutlich, nicht darin erschöpfen, dass da einer in gleichgesinnter Umgebung mal ordentlich Dampf ablässt und anschließend zur Tagesordnung übergeht. Er veröffentlicht sie auf Tonträger und nimmt damit ganz bewusst sämtliche Konsequenzen seiner Schmähung in Kauf. In den achtziger und neunziger Jahren hat er fast alle konservativen bayerischen Spitzenpolitiker persönlich beleidigt, wohlwissend, dass dafür erhebliche Strafgelder anfielen, die bei Söllner im Lauf seiner Karriere wohl in die Hunderttausende gingen.
Dahinter wird ein bemerkenswertes Widerstands-Konzept erkennbar: Der Wahrhaftigkeitsanspruch des eigenen Textens wird durch die Bereitschaft zu empfindlichen finanziellen Verlusten beglaubigt, die Großkopferten werden dadurch zugleich gezwungen, die Kleinen und ihre Unbestechlichkeit überhaupt wahrzunehmen. In dem Lied „Gerechtigkeit“ von der Platte „Für Marianne und Ludwig“ (1986) heißt es, angesichts der miserablen Verhältnisse in der Welt könne es nur noch darum gehen, ein „kleines Arschloch unter großen“ zu sein. Die alte, archaische Form des Spottlieds ist für Söllner dabei das perfekte Medium.
Zu einer Neubesinnung Söllners kommt es im Jahr 1986. Da reist er zum ersten Mal nach Jamaika, und die lässige Lebensweise der Karibikinsel färbt spürbar schon auf die Platte „Wos reimt se scho auf Nicki“ (1987) ab; das Orchestrale nimmt zu. Neben dem Hanf erscheinen in Söllners Texten weitere positive Bezugspunkte: die Geburt des ersten Sohns, überhaupt das private Glück („Wos kon i mera verlanga?“), weiterhin der Tanz und eine neue Form des dialektischen Abwägens, bei dem die optimistische Weltsicht zumindest gelegentlich einen leichten Vorsprung davonträgt.
Im Jahr 1993 tritt Söllner aus der katholischen Kirche aus und bekennt sich zur Rastafari-Religion, er wird Vegetarier. Die anschließende Platte „Grea Göib Roud“ (1995) ist eine eher dunkle, die an die Dylan-Alben der Neunziger erinnert. Einen sympathischen Familienmenschen mit grünem Daumen, dessen Lachen nicht über einen spürbaren Weltschmerz hinwegtäuschen kann, zeigt der Dokumentarfilm „Wer bloß lacht, is ned frei“ aus dem gleichen Jahr. Musikalisch schlägt der Reggae jetzt endgültig durch. Immer häufiger taucht in Söllners Songs an exponierter Stelle ein prophetisch-animierendes „He!“ auf, zuweilen verbunden mit einem dann doch etwas rührend klingenden „Steht’s auf, Leit“. Als „Wanderprediger“ bezeichnet er sich scherzhaft zu dieser Zeit.
Söllners politische Einstellung scheint sich seit dem Album „Hey Staat“ aus dem Jahr 1989 kaum verändert zu haben. Das Konzept „Staat“ lehnt der radikale Inzweifelzieher von allem, was ihm nicht einleuchtet, nach wie vor ab. Gegen welche Staatsform er sich dabei genau richtet, bleibt unklar, durchaus anregend umreißt er in der erwähnten Dokumentation seine Idealvorstellung: einen Individualanarchismus ohne übertriebenen Kollektivbesitz, eingebettet in selbstverwaltete Kleinsteinheiten: „Europa und Deutschland sind im Grunde auf einer menschlichen Basis unverwaltbar für mich. Es geht die Menschlichkeit immer drauf, weil du wahnsinnig viele Menschen gleich behandeln müsstest – eigentlich.“
Die gelungenste künstlerische Umsetzung findet Söllners Anarchismus in dem Titelsong des Albums „A Jeda“ (1997), dessen Cover ihn, sehr passend zum Hofnarren-Motiv, als Rebellen in Denkerpose mit Kappe zeigt. Musikalisch bricht sich ein neuer, trancehafter, karibischer Ton Bahn, Söllners Gitarrenspiel, das er früher zurecht als „mittelmäßig“ bezeichnete, zeigt sich plötzlich auf höchstem Niveau. Die Texte der Platte sind teils aufreizend entspannt („Boarischa Krautmo“), teils kämpferisch und manchmal auch sehr gehässig („Blues“). Nur der mit knapp drei Minuten recht kurze Einstiegssong, „A Jeda“ fällt aus dem Rahmen.
***
Zu einem ungewöhnlich munteren Gitarrengezupfe erklingt in dem Lied nicht die bei Söllner sonst so übliche Kasperle-Stimme, sondern eher die eines abgeklärten Chansonniers, der aber in breitem Bayerisch ganz naive Fragen stellt: „Is jetzt des deins oda is jetzt des seins? Oda g’heat des ihr oda is des des von mia?“ Ja, wem gehört das eigentlich alles – der Strand, die Bäume, die Berge und Tiere, das Wasser, das Geld? Söllner presst die besitzanzeigenden Fürwörter fast gequält heraus, und der Hörer muss sich wundern, dass er selbst sich abgewöhnt hat, über diese Fragen nachzudenken.
Schon nach zwei Zeilen gibt es einen Bruch, der mit einem „He!“ und einem wurstigen „geh weida“ eingeleitet wird. Zum ersten Mal singt Söllner die Forderung „Ja gib hoit a moi a bissl wos her“, die im Lauf des kurzen Liedes dutzendfach wiederholt wird – ein „bissel was“ geht ja bekanntlich immer.
Doch die Verwirrung des Sängers ist noch nicht beigelegt, eine räumliche kommt hinzu: Wo genau sind die Grenzen der Besitzverhältnisse, fragt er sich, wo genau liegen sie zwischen Oben und Unten? Seine Forderung (Gib mal ein bisschen was her!) wiederholt er jetzt noch eindringlicher, bevor endlich der Refrain („A jeda gibt a bissl wos, a jeda nimmt a bissl wos“) für einen Akt der Befreiung sorgt.
Die Musik wird plötzlich volksliedhaft, die erlösenden Verben „Geben“, „Dürfen“ und „Können“ werden geradezu erleichtert ausgestoßen. Der Text skizziert die Utopie eines allgemeinen Austauschs, und die Musik schafft eine Verbindung, die noch darüber hinausgeht. Mit waghalsigen, an Willy Michl erinnernden Zeilensprüngen müssen sich vor allem die fragenden Passagen dem Söllnerschen Groove anpassen, das Bayerische klingt dabei wie eine einzige Lautmalerei. Großartig, wie Söllner allein im Mittelteil die Phrase „a-moi-a“ (also: „einmal ein“) ins Trancehafte steigert.
Musikalisch-textlich führt Söllner in dem Lied jedes grenzziehende Besitzstands- und Konkurrenzdenken ad absurdum; die Dialektik des „A Jeda“, die darin besteht, dass jeder Mensch nicht nur gerne gibt, sondern auch gerne behält, wird durch die raffinierte Stimmigkeit des Liedes einfach weggesungen. Am Schluss erlaubt sich der Song sogar eine kleine Kakophonie, unverständlich wird er dabei nicht:
Sog amoi, du he ha sog amoi, he, du sog ha
An jedn steht a bissl wos zua, is des so schwa
Ha sog amoi, du he, sog amoi ha, he sog amoi ha-ha!
Ist es denn wirklich so schwer mit den Besitzverhältnissen? Teilen ist ja eigentlich ganz leicht, auch wenn die Kosequenzen zuweilen unangenehm nachwirken. Wer sagt, dass Söllners Botschaft utopisch ist, muss zugegen, dass sie im Grunde nur christlich ist. Könnte „A Jeda“ in seiner Eingängigkeit auch ein bayerisches Volkslied sein? Erstaunlich, dass ein textlich derart radikaler Altruismus in der populären Musik eigentlich kaum vorkommt.
***
Und nun, mehr als zwanzig Jahre nach „A Jeda“, will Hans Söllner also in Bad Reichenhall Bürgermeister werden. Die erste Hürde hat er schon genommen, der Wahlausschuss hat ihn zugelassen. Möchte man ihm raten, in dem satten Luftkurort mit seinem Bürgebräu und den Plüschcafés die Anarchie auszurufen? Eher nicht. Aber Recht hat Söllner mit „A Jeda“ trotzdem, und der Zeitgeist scheint ihm allmählich sogar zuzuarbeiten.
***
„A Jeda“
Is jetzt des deins oda is jetzt des seins?
Oda g’heat des ihr oda is des des von mia?
Geh weida, gib hoit ma a bissl, jo gib hoit a moi a bissl
Ja gib hoit a moi a bissl wos her, Mensch, gib hoit a mal a bissl
Ja gib hoit amol a bissl, gib hoit a bissl wos her
Is des des von eam oda is des des vo ihr oda is des des von drent
Oda von herent oda von drob’n oda viellecht des von drun’t?
Geh weida, gib hoit amoi a bissl, ja gib hoit amoi a bissl
Jo gib hoit amoi a bissl wos her, gib hoit endlich amoi a bissl wos
Bloss a bissl wos, bloss a bissl wos her
A jeda gibt a bissl wos, a jeda nimmt a bissl wos
A jeda derf a bissl wos, a jeda hot a bisl wos
A jeda konn a bissl wos, a jeda muaß a bissl wos
Und a jeda is a bissl wos, is des so schwa-ha
Is jetzt des des vo drob’n oda is des des von drunt oda von drübn
Oda von herübn oda von drent oda von herent oda von vis-a-vis?
He, geh weida, gib, Mann, gib hoit amoi a bissl, ja gib hoit amoi a bissl
Hargoodsakrament, gib hoit amoi a bissl wos her
Gib hoit amoi a bisl wos her, bloß a bissl wos her
Is jetzt des des von eich oda is des des vom Herrn Reich
Oda g’hert des uns oda is des für olle do oda g’heat des bloß oam oda koam?
Geh weida, gib hoit amoi a bissl wos, ja gib hoit amoi a bissl
He gib hoit amoi a bissl wos her, gib hoit wos her gib hoit wos her
Gib hoit wos her
A jeda soi a bissl wos und a jeda wui a bissl wos
A jeda kriagt a bissl wos, a jeda trogt a bissl wos
A jeda hölft a bissl wos, a jeda sogt a bissl wos
Und a jeda wead a bissl wos, is des so schwa-ha
Is jetzt des des von vis-a-vis oda is des des von di
Oda is des des vo sie oda is des des von eam?
He, ge weida, gib hoit amoi-ja, gib hoit amoi-ja
Gib hoit amoi a bissl wos, gib hoit amoi a bissl wos
Gib hoit amoi a bissl wos her, gib hoit wos, gib hoit wos her
Is jetzt des des vo olle oda von drob’n oda von drunt
Oda von herent oda von drent, von ob’n oda von unt?
He, geh weida, gib hoit amoi a bissl, gib hoit amoi a bissl wos her
Gib hoit amoi a bissl wos, gib hoit amoi a bissl wos her
Gib hoit wos her, gib hoit wos her
A jeda trinkt a bissl wos, a jeda isst a bissl wos
A jeda schlaft a bissl wos und a jeda liebt a bissl wos
An jedn geht a bissl wos am Oarsch vabei a bissl wos
He, an jedn steht a bissl wos zua, is des so schwa-ha
Sog amoi, du he ha sog amoi, he, du sog ha
An jedn steht a bissl wos zua, is des so schwa
Ha sog amoi, du he, sog amoi ha, he sog amoi ha-ha!