Maschinenoptimierte Überschriften und Software, die selbständig Spielberichte und Wirtschaftsnachrichten verfasst – die Automatisierung journalistischer Textproduktion hat gerade erst begonnen.
Als ich Mitte der Achtziger das Berufsziel Journalist ins Auge fasste, war ich mir einigermaßen sicher, dass ich zwei Dinge wohl nicht erleben werde: dass das Schreiben von Meldungen, Berichten und Reportagen in Billiglohnländer ausgelagert wird und dass zweitens in meiner zu erwartenden Lebensspanne die Computertechnik in die Lage kommen sollte, selbsttätig Berichte zu verfassen und somit den Journalisten entweder überflüssig zu machen oder zum Technikbediener umzuwidmen.
Was den zweiten Punkt angeht, muss ich gestehen: Da habe ich die Entwicklung wohl unterschätzt. Schreibsoftware ist dem Vernehmen nach inzwischen tatsächlich in der Lage, in journalistischen Standardsituationen wie Spielberichten, Wahlanalysen oder auf Kennzahlen basierenden Unternehmensnachrichten lesbare Berichte zu verfassen. Beim US-Wirtschaftsmagazin „Forbes” kommen automatische Schreibprogramme des Herstellers Narrative Science ebenso zum Einsatz wie beim College-Sport-Sender „The Big Ten Network”, der damit nur wenige Minuten nach Spielende zu jedem Spiel einen Kurzbericht online stehen hat. Bei „Forbes” sind es vor allem auf Zahlen wie Umsatz, Gewinn und dergleichen basierende Berichte über Unternehmen, bei denen narrative science als Autor zeichnet. Das heißt, Kollege Computerprogramm spielt überall dort seine Stärken aus, wo es darum geht, aus Zahlen- und Datensammlungen in sehr kurzer Zeit lesbare Texte zu generieren.

Frank Rieger vom Chaos Computer Club hat in seiner Trendgeschichte über Automatisierung eine interessante Induktionsschleife in diesen Informationskreisläufen herausgearbeitet: „Die von den Textsynthese-Algorithmen erstellten Meldungen über Unternehmen und den Handelsverlauf an der Börse werden wiederum von automatischen Börsenhandelssystemen erfasst und analysiert, die daraus eigentlich Indikatoren über die Stimmung am Markt ableiten sollen. Die aus den automatisch erstellten Börsenmeldungen extrahierten Daten fließen so wiederum in die algorithmischen Handelsaktivitäten ein: Algorithmen schreiben für ein Publikum der Algorithmen.” Das stimmt sogar in mehrfacher Hinsicht, schließlich zielen diese automatisch erstellten Texte nicht allein auf Publikum aus Fleisch und Blut – sondern auch auf Suchmaschinen. Und da können diese zu minimalen Personalkosten hergestellten Textprodukte dem Seitenbetreiber wertvolle Dienste leisten, wenn sie Suchmaschinentraffic generieren und das Ranking der Seite in der Suchergebnisliste verbessern. Aber da stellt sich irgendwann schon die Frage, ob das langfristig auf ein Modell hinausläuft, das der Satiriker Ephraim Kishon skizziert hat, als die ersten erschwinglichen Schachcomputer auf den Markt kamen. Das brachte Kishons Freund Jossele dann nämlich auf die Idee, gleich zwei davon zu kaufen, gegeneinander spielen zu lassen und derweil ins Kino zu gehen.
Holger Schmidt, bis vor kurzem im Dienste dieser Zeitung und jetzt Netzökonomie-Blogger bei focus.de, hält es aber für wenig wahrscheinlich, dass der Journalistenberuf in naher Zukunft obsolet gemacht wird von Textprogrammen: „Computer schreiben nur Artikel, die sonst nicht entstehen würden. Die Computer können auch nicht recherchieren, Geschichten ausgraben oder Interviews führen.” Für die Texte würden weiterhin auch richtige Journalisten benötigt, die passende Textpassagen vorschreiben, die später immer wieder verwendet und neu zusammengesetzt werden können. Auch für die persönliche Note der Texte seien die Kollegen aus Kohlenwasserstoff zuständig.
Aber die siliziumbasierte Konkurrenz holt auf: Softwarefirmen haben den Online-Journalismus als Absatzmarkt entdeckt und bieten allerlei Dienste und Werkzeuge zum Optimieren von Inhalten feil. Der Anbieter Visual Revenue preist ein Analyseprogramm an, das die Durchschlagskraft von Online-Überschriften messen kann. Das sogenannte “Instant Headline Testing” soll die Klickraten auf Websites in nie gekannte Höhen klettern lassen. Bislang mussten Schreiber sich auf ihr Bauchgefühl und die überlieferten Weisheiten erfahrener Schlagzeilenklöppler verlassen. Jeder Volontär oder Journalistenschüler dürfte schon mal von der Ideal-Überschrift gehört haben, die der Entertainer Rudi Carrell vor Jahrzehnten mal so getextet hatte: „Deutscher Schäferhund leckt Inge Meysels Brustkrebs weg”. Da ist alles drin, was emotionalen Wallungswert verspricht, die Nation, das beliebte Haustier, die Brust für das Thema Nummer eins (Sex), der Krebs stellvertretend für Schicksalsschlag und Inge Meysel als prominente Person. Den Part müssten heute eher Verona Pooth oder Daniela Katzenberger spielen, aber ansonsten dürfte diese Ideal-Headline immer noch einen brauchbaren Weg zur hohen Anklickrate weisen.

Ob es uns Medienschaffenden nun passt oder nicht: Diese technischen Hilfsmittel, die wahrscheinlich noch ganz am Anfang ihrer Möglichkeiten stehen, stellen nicht nur unsere gewohnten Arbeitsabläufe in Frage, sondern unser gesamtes Selbstverständnis. Kurzfristig gesehen hat “Meedia”-Redakteur Christian Meier sicher recht mit seiner Frage, ob es uns mit diesen Werkzeugen gehen könnte wie mit dem Navi im Auto: „Erst mal dran gewöhnt, geht am Ende jegliches Gespür dafür verloren, wie man von A nach B gekommen ist und wo um Himmels willen man überhaupt gerade herumgurkt.” Aber die Fähigkeiten der Programme, den Erzählduktus journalistischer Stilformen zu adaptieren und zu reproduzieren, vielleicht sogar persönliche Stilmarotten anzunehmen, werden sich noch weiter entwickeln. Und damit stellt sich irgendwann die Frage, was genau macht eigentlich den spezifisch-menschlichen Faktor in der Berichterstattung aus?
Seien wir doch mal ehrlich: Auch heute schon würde ein Gustave Flaubert verzweifeln, wenn er sich an einer Neuauflage seiner legendären Platitüdensammlung „Das Wörterbuch der Gemeinplätze” versuchen würde. In den Redaktionen jeder Gattung grunzen die prall gemästeten Phrasenschweine, und wer von uns noch kein Klischee bedient hat, der werfe den ersten Stein. In meiner früheren Bürogemeinschaft hatten wir vor Jahren mal scherzhaft rumgehirnt, wie eine typische Geschichte in „werben & verkaufen” anzuteasern wäre. Das läse sich etwa so: „Der Agenturmarkt ist in Bewegung. Junge, ambitionierte Newcomer-Agenturen versuchen den etablierten Networks mit pfiffigen Ideen Kunden und Marktanteile abzujagen.” Und was soll ich sagen, vor ein paar Monaten fand ich fast exakt diese Satzkonstruktion im w&v-Inhaltsverzeichnis. Warum sollte es Computerprogrammen dauerhaft verwehrt bleiben, solche sprachlichen Muster zu erkennen und zu reproduzieren?
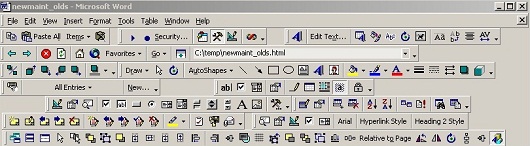
In der Lokalberichterstattung sehe ich auch einiges Automatisierungspotenzial. Geben wir dem Computer ein paar Eckdaten wie das Datum, den Namen und Zweck der Veranstaltung sowie die Wetterdaten am fraglichen Tag, dann sollte ein Programm doch durchaus in der Lage sein, die Sorte von Bericht abzuliefern, die der Journalist und Lokalblogger Hardy Prothmann mit dem schönen Begriff Bratwurst-Journalismus bezeichnet hat: „Obwohl die Aussichten nicht gut waren, zeigte sich der Wettergott letztlich doch gnädig und grüßte mit Sonnenstrahlen die Festbesucher – sehr zur Freude der zahlreichen Gäste. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Wie es sich für ein zünftiges Fest gehört, löschten viele mit kühlen Gerstensaft ihren Durst und ließen sich natürlich wie jedes Jahr die leckeren Bratwürste schmecken.” Die handelnden Personen sind meist „voll des Lobes und Dankes”, da wird „unterstrichen”, „betont” und „hervorgehoben”, „sich gefreut” und „scherzhaft angemerkt”, „sich erinnert” und „erklärt”. Im Kern, so Prothmann, handle es sich dabei um aufgepumpte Phrasen, also Bratwurstpoesie.
Wenn selbst diese publizistische Bastion des Lokalen von den Replikanten und Schreibrobotern erobert ist, dann sind vielleicht die Blogs das letzte Zufluchtsgebiet, wo der Mensch noch Mensch sein darf und wo die Subjektivität ihr Reservat findet. Andererseits: Wenn die FAZ auf die Idee käme, ein Schreibprogramm in Konkurrenz zu „Stützen der Gesellschaft”, „Ding und Dinglichkeit” und „Deus ex Machina” bloggen zu lassen, wäre ich auf das Ergebnis schon mal gespannt. Oder um es mit einem abgegriffenen Klischee zu sagen: Konkurrenz belebt das Geschäft.



