Leserkommentare können für Online-Publikationen ein Segen sein. Aber Meinungsbiotope brauchen entsprechende Hege und Pflege, sonst stinken sie wie umgekippte Binnengewässer.
Da hat Markus Beckedahl ja was losgetreten. Vor einigen Tagen ließ der Betreiber des vielgelesenen Blogs netzpolitik.org seinem Frust über die Kommentare freien Lauf: In den vergangenen acht Jahren hat Beckedahl nach eigenen Angaben rund 130.000 Kommentare auf seiner Seite gelesen – „und leider waren die meisten Zeitverschwendung”, bilanziert der netzpolitik.org-Gründer. Jahrelang habe er sich bemüht, auf (fast) jeden Kommentar einzugehen, krude Verschwörungstheorien zu relativieren, auf jede Frage eine Antwort zu versuchen, Beleidigungen oder Formulierungen kurz davor zu gängeln, ganz schlimme Kommentare zu löschen und einen transparenten Hinweis darauf zu formulieren. „Ich war motiviert und ich war geduldig”, schreibt Beckedahl. „Das hat sich geändert: Ich hab da echt keine Lust mehr drauf.”
Dennoch – oder gerade drum – war das Echo gewaltig: Bis dato erzeugte Beckedahls Brandrede über 350 Kommentare und einen Folgebeitrag, der sich ein paar konstruktivere Gedanken macht, wie netzpolitik.org mit dem Leserecho künftig verfahren soll. Zwischen den Polen „Kommentarfunktion schließen” und „alles stehen lassen” haben Onlinemedien eine Palette von Möglichkeiten, mit dem Thema umzugehen: aktives Freischalten von Kommentaren (wie es z.B. hier in den FAZ-Blogs praktiziert wird), Auslagern der Kommentarfunktion an externe Plattformen wie Facebook ode Disqus, händisches Sortieren anhand von selbst aufgestellten Kommentarregeln und, und, und. Das erfordert Zeit und Nerven, aber wirklich darauf verzichten mögen auch nur die wenigsten Betreiber. Denn im Idealfall sind zwischen all den Wortmeldungen eben auch ein paar Perlen dabei, welche die Diskussion voranbringen und das Thema weiterentwickeln. „Kommentare im Netz sind ein noch lange nicht beendetes Experiment”, schreibt Kai Biermann bei zeit.de. Jede Seite, jeder Anbieter müsse für sich entscheiden, wie viele und welche er wie zulassen will, so Biermann: „Sie abzuschalten ist keine Lösung, denn damit hat niemand gewonnen. Weder Betreiber, noch Leser, noch die, die sich beteiligen wollen.”

In das Hohelied der Kommentarkultur stimmt sogar der Deutsche Journalistenverband (DJV) mit ein: Leserkommentare und Blogbeiträge in Medien seien Teil der demokratischen Debattenkultur, gibt der DJV-Vorsitzende im Branchendienst meedia.de zu Protokoll. Und warnt zugleich: “Wenn Medien aus Personalmangel die Kommentare stiefmütterlich behandeln, suchen sich die User auf Dauer andere Plattformen zur Kommunikation”, so Konken. Zudem müsse die Kommentar-Verwaltung Aufgabe von erfahrenen Journalisten sein. Es sei „unverantwortlich”, wenn Verlage für diese Aufgabe aus Kostengründen ungelernte Hilfskräfte einspannten. Wobei erfahrene Journalisten freilich auch kein Garant dafür sind, dass sich eine fruchtbare Kommentarkultur entwickelt. Traditionell ist die Leserbriefredaktion in der Ressort-Hierarchie von Zeitungen ziemlich weit unten angesiedelt , und das ändert sich Online auch nur in sehr kleinen Schritten. Viele Journalisten sind direktes Leserfeedback nicht gewöhnt, und sich mit dem Kommentariat auseinanderzusetzen, empfindet mancher Kollege immer noch als Zumutung.
Wer sich im Blätterwald auf die Suche nach best-practice-Beispielen macht, dürfte (neben einigen handverlesenen FAZ-Blogs natürlich) am ehesten bei der alten Tante „Zeit” fündig werden. Dort liest laut Auskunft von Redakteur Kai Biermann ein ganzes Team von Moderatoren rund um die Uhr alles, was Kommentatoren schreiben und prüft bei jedem einzelnen Text, ob und in welchem Umfang er im Zweifel bearbeitet werden muss. Das bedeutet bei durchschnittlich 15.000 Kommentaren in der Woche einigen Aufwand. Aber: „Die Handarbeit lohnt sich für eine Redaktion, weil in den Kommentaren Themen weiterentwickelt werden”, schreibt Biermann. Das setzt aber voraus, dass sich der Autor eines Artikels auch selbst in die Diskussion einklinkt und nicht nur darauf wartet, dass ihm die Früchte der Gedankenarbeit der Leserschaft in den Schoß fallen – und dass ansonsten das Community-Management den Wachhund spielt, um die Diskussion in erträglichen Bahnen zu halten. Anfangs beschränkten sich die redaktionellen Interventionen zeit.de zumeist auf gouvernantenhafte Ermahnungen wie „Halten Sie sich an die Netiquette” oder „Bleiben Sie beim Thema”. Inzwischen zeigen die Verfasser der Artikel auch selber ab und zu Flagge in den Diskussionsrunden unter ihren Beiträgen. Und wie es scheint, ist das Feedback unter dem Strich eher positiv, wenn die Foristen den Eindruck haben, man nimmt sie ernst und greift ihre Gedanken auch auf.
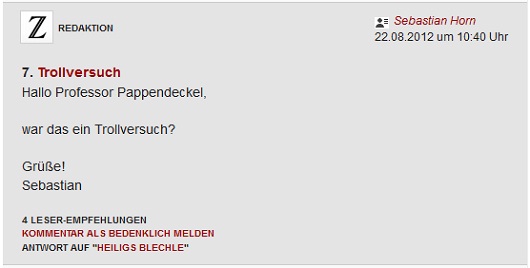
Aber selbst das beste Community-Management wird nicht wirksam verhindern, dass eine Kommentarmöglichkeit auch Spinner und Nervensägen anlockt. „Jedes Blog, egal, ob bekannt oder klein, kennt die Dauerbesserwisser, die ‚ist-ja-sowieso-alles-Sch*‘-Finder, die Randalettis, die einfach-nur-mal-ein-bisschen-rumnerven-Woller, die Spinner und die Allesdurchblicker”, schreibt Vera Bunse auf carta.info. Und bei den großen Zeitungsangeboten dürfte das Trollaufkommen eher noch größer sein, weil die vielgelesenen Sites den Stänkerern mehr Reichweite versprechen. Aber der drohende Effekt ist bei großen und kleinen Plattformen der gleiche: Diejenigen, die bereit sind, in der Sache zu diskutieren und tatsächlich nach Problemlösungen zu suchen, verlieren die Lust am Diskurs und wandern ab in andere Gefilde.
Aber folgt das irgendwelchen Naturgesetzen, dass im Netz vielerorts so rüde rumgeholzt wird in Debatten? Vielfach herrscht ja der Glaube vor, die Anonymität in Netzdiskursen sei der Faktor, der bei den Teilnehmern die Sau vom Pflock lässt. Jetzt hat ein europäisches Konsortium aus Forschern verschiedener Fachrichtungen interessante Befunde über die Diskussionskultur in Blogs, Foren und sozialen Netzwerken vorgestellt. Emotionspsychologen, Informatiker, theoretische Physiker sowie Experten für künstliche Intelligenz, virtuelle Realität und komplexe Systeme sind unter dem Projektnamen „Cyberemotions” der Frage nachgegangen , warum oft so heftig und emotional gestritten wird. Eine der zentralen Ursachen hierfür liegt nach Ansicht der Forscher darin, dass in Netzdebatten meist Menschen aufeinandertreffen, die sich nicht kennen. Das klingt zunächst banal – und widerspricht auf den ersten Blick auch nicht unbedingt dem gängigen Erklärungsansatz mit der Anonymität. Aber letztere ist laut Psychologieprofessor Arvid Kappas von der Jacobs University in Bremen nicht der springende Punkt, wie sein Experiment mit zwei Kleingruppen zeigt. Beide Gruppen bestanden aus jeweils zwei Personen, die über das Internet ein bestimmtes Thema diskutieren sollten. Die eine Gruppe konnte sich vorher kennenlernen, in Erfahrung bringen, wo die andere Person herkommt, was sie macht. Die andere Gruppe startete sofort in die Diskussion. Der Befund: Die Diskutanten, die sich vorher nicht über persönliche Dinge unterhalten haben, sprangen rauer miteinander um als diejenigen, die sich vorher gegenseitig kennengelernt hatten.
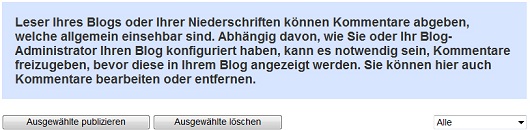
Selbst wenn das Experiment aufgrund der niedrigen Fallzahl nur von beschränkter Repräsentativität für die Netzszene sein dürfte, das Ergebnis klingt irgendwie plausibel. Sowohl drüben in meinem kleinen Privatblog als auch hier auf der FAZ-Plattform ist es für den meistens recht angenehmen Gesprächston nicht entscheidend, dass jeder die Klarnamen von allen Mitwirkenden kennt. Aber da sich hier wir dort mit der Zeit Zirkel von immer wieder mitdiskutierenden Teilnehmern gebildet haben, ist doch eine gewisse Vertrautheit da. Vereinzelte Ausreißer, die es hier wie dort auch gelegentlich gibt, fallen nicht wirklich ins Gewicht. Und ich nutze die Gelegenheit, den hier Mitdiskutierenden dafür, dass es sich hier immer wieder so schön debattieren lässt, ein herzliches Dankeschön zu sagen.
Bild 2: Screenshot von www.zeit.de



