Eines muss man den Anhängern der Post-Privacy-Ideologie ja neidlos lassen: Ihre Thesen vom Ende der Privatheit im digitalen Zeitalter schlagen Wellen. Die Presse lädt sie zu Interviews, man lässt sie in Funk und Fernsehen ausführlich zu Wort kommen. Die Frage , welche Folgen die Digitalisierung unseres Daseins für die Bereiche hat, die wir bislang als privat betrachteten und wie eine neue netzbasierte Form von Öffentlichkeit aussehen könnte, treibt viele um. Und wie das im Medienbetrieb läuft, wissen wir ja: Je knackiger die Thesen formuliert sind, desto größer die Chance, Gehör zu finden und ein Echo zu erzeugen. Also haut man ganz unbekümmert ein paar Klopper-Sprüche raus wie „Privatsphäre ist der Ort, wo Ehefrauen geschlagen werden” oder „Datenschutz ist ja sowas von Eighties.”
Aber eines sollte der geneigte Betrachter angesichts der enormen Präsenz der Postprivatisten nicht völlig aus den Augen verlieren: Diese Verächter der Privatphäre sprechen nicht für das Netz. Oder auch nur für die Mehrheit der Netzgemeinde. Die Auffassung, dass auf Privatsphäre im herkömmlichen Sinn gut zu verzichten ist, wird nur von einer kleinen, aber lautstarken Minderheit vertreten. Einige dieser Zeitgenossen haben sich – nachdem sie von der CCC-Frontfrau Constanze Kurz auf einer Veranstaltung als „Post-Privacy-Spackos” geschmäht wurden, unter dem Kampfnamen „Spackeria” formiert. Jetzt findet sich auf der anderen Seite des Meinungsspektrums eine Gruppierung unter dem selbstironischen Namen „Aluhüte” zusammen. Mit diesem Begriff, der Anhänger von Verschwörungstheorien, Paranoiker oder sonstwie sehr anstrengende Menschen bezeichnet, hatte der Blogger Kristian Köhntopp die datenschutz-affine Fraktion innerhalb der Piratenpartei bezeichnet. Und so ist es für diese Fraktion eine Frage der Ehre, dieses geschmähte Kennzeichen der Sonderlinge zu ihrem Markenzeichen zu machen.

Ehrlicherweise muss man sagen, dass auf dem eigens eingerichteten Blog der Aluhüte außer einem mission statement noch nicht viel zu lesen ist. Und so nimmt es der Verfasser dieses Blogs selber in die Hand, sich ein Stanniolkäppi aufzusetzen und (mal wieder) den Diskurs mit den Datenschutz-Kritikern zu aufzunehmen. Im Kern lautet die Kritik der Postprivatisten am Datenschutz, dass er personenbezogene Daten nicht wirksam schützen könne. Die zunehmende elektronische Vernetzung des Daseins bringe es unausweichlich mit sich, dass der Einzelne immer weniger kontrollieren könne, wer was mit seinen personenbezogenen Daten so alles anstellt. Aus diesem Dilemma heraus verausgabten sich die Datenschützer auf allerlei Nebenschauplätzen wie zum Beispiel Google Analytics, Street View oder Facebook-Like-Buttons. Und zunehmend werde der Datenschutz von der Politik auch zum Vehikel der Netzzensur und anderer unschöner Entwicklungen umfunktioniert.
Freilich können auch die schärfsten Datenschutz-Kritiker nicht von der Hand weisen, dass die zunehmende Durchleuchtung und Transparenz unserer Einzelexistenzen durch Unternehmen, Arbeitgeber und die Obrigkeit das Machtgefälle in der Gesellschaft durchaus zu unseren Ungunsten verschieben kann. Die Kontrolle, die der einzelne über seine Daten verliert, ist ja nicht weg – es hat sie womöglich nur jemand anders. Nämlich derjenige, der den Zugriff auf die ganzen aggregierten Einzeldaten hat. Das kann der Staat sein, Handel und Kreditwirtschaft oder auch nur der Internet-Provider.

Aber auch für dieses Problem des Machtgefälles sehen die Privatsphären-Verächter eine einfache Lösung: Man brauche ja nur beiden Seiten Transparenz auferlegen. Da müsste dann beipielsweise ein Arbeitgeber seinen Besetzungs- und Auswahlprozeß für eine Stelle genau so offen legen wie die Bewerber ihre Daten. Dann werde man schon sehen, wie lange Unternehmen sich unlautere Einstellungs-Usancen im Lichte der öffentlichen gesellschaftlichen Diskussion erlauben könnten. Oder Stichwort „Open Government”: Hinter diesem Schlagwort steht das Bestreben, Regierungshandeln und Verwaltung transparenter zu machen und den Bürger mehr als bisher auch mit modernen elektronischen Mitteln einzubeziehen. Oder noch einen Schritt weiter gedacht bis hin zu „Open Data”, dem Verfügbarmachen aller möglichen Datenbestände zum allgemeinen Nutz und Frommen ohne Einschränkung durch Urheber und Lizenzrechte und dergleichen mehr.
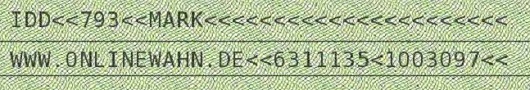
Das klingt ja alles schon schön und gut, es gibt da aber einen entscheidenden Haken an der Sache: Diese schöne, neue Welt der Informationssymmetrie und Waffengleichheit zwischen Individuum und größeren Instanzen wird sich nicht ohne Kämpfe und Widerstände von selbst materialisieren. Und wenn man sich genauer anschaut, warum der Datenschutz in vielen Punkten hinter seinen Möglichkeiten und Ansprüchen hinterherhinkt, wird man auch besser verstehen, wo das eigentliche Problem liegt. Die Gründe, warum das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung in der Praxis kaum mehr durchzusetzen ist und der Datenschutz in vielen Belangen zum Papiertiger geworden ist, sind nicht primär informationstechnologischer Natur – sondern politisch. Selbstbestimmung über die Verwendung unserer personenbezogenen Daten liegt weder im vitalen Interesse unseres Schnüffelstaates mit seinen weitreichenden Überwachungs-Begehrlichkeiten noch im Interesse der vielen Wirtschaftszweige, die vom Adresshandel, Konsumenten-Profiling und Bonitätauskünften direkt und indirekt profitieren. Wenn man Staat und Wirtschaft schon keine wirksamen Datenschutz-Regelungen verordnen konnte, mit welchen Mitteln soll man sie denn dann bitteschön dazu kriegen, ihre sämtlichen Entscheidungsprozesse und ihnen zugrundeliegenden Daten öffentlich zu machen? Wo kämpft denn die datenschutzkritische Spackeria für mehr Transparenz in Politik, Wirtschaft und Verwaltung und gegen das wachsende Machtgefälle, das aus der Informationsasymmetrie resultiert? Ich verstehe nach wie vor nicht, wie es zugehen soll, dass wir in der besten aller denkbaren Welten landen, wenn wir uns alle nur genug entpixeln und nackig machen. Und so werde ich mich einstweilen hüten, mein Stanniolkäppi vorschnell in die Recyclingtonne zu treten.
Ach ja, und ein nettes Detail dazu noch am Rande: In dem Wikipedia-Eintrag zum Stichwort „Aluhüte” ist mein FAZ-Blogbeitrag über die Dotcomsomolzen die Fußnote Nummer eins. So schließt sich der Kreis.



