Man wäre zu gern bei der Redaktionskonferenz gewesen, die über das Titelblatt der deutschen Erstausgabe der Zeitschrift Wired befunden hat. Wired aus dem Verlagshaus Conde Nast steht in den USA – oder zumindest in der Eigenwerbung – für hochwertigen Journalismus der digitalen Ära, aufgeschlossen, mutig, offen und immer bereit, die Leser zu überraschen. Manchmal hat Wired die Zukunft verkündet, und manchmal groteske Fehleinschätzungen, und es hat sogar die New Economy überlebt. Dieser Dinosaurier des Digitalzeitalters also kommt nach Deutschland. In München bei Conde Nast sassen sie also zusammen, die Vordenker und Blattmacher, und überlegten, welches der Themen auf den Titel durfte. Der Umgang mit Kalorien? Ein Frauenthema vielleicht? Kunst? Visionen? Es gab viele Optionen. Am Ende aber muss jemand gesagt haben: Schluss damit, wir machen das, was sich verkauft. Sex. Drogen, Autos. Und unseren Lesern – den technikaffinen Geeks – soll Deutschland gehören. Darunter machen wir es nicht, denn was die Bild kann, können wir auch.

Teetischbar
So wurde es gedruckt. So liegt seit heute an den Kiosken dem inoffiziellen Zentralorgan der hauptschulabgebrochenen Muckibudenbesitzer namens GQ bei. Und der nicht ganz so geekige Betrachter fragt sich: Soll man dieses Land wirklich einer Zielgruppe anvertrauen, für die Sex, Drogen und neuartige Autos die richtigen Kaufanreize sind? Ist der Geek der studienabgebrochene Coderbudenbesitzer des Internets?
Der Geek ist das Leitmotiv des Heftes. Er ist die nach Meinung von Conde Nast und Chefredakteur Thomas Knüwer bislang etwas vernachlässigte Zielgruppe, die in Deutschland noch niemanden hat, der sie als cool, gewitzt und die Zukunft des Internets und des Landes darstellt. Das trieft bei Wired Deutsch aus allen Poren, dieser Wunsch, auch wer zu sein, Teil einer Jugendbewegung, und dazu ist sich Thomas Knüwer zusammen mit anderen auch nicht zu schade, die alte Verschwörungstheorie der deutschen Technikfeindlichkeit hervorzuholen. Gruppen definieren sich nun mal über Gemeinsamkeiten und gemeinsame Gegner. Wenn die Gemeinsamkeiten bei technisch interessierten Internetnutzern nicht allzu gross sind, müssen eben gemeinsame Feinde her. Wenn sie in einem Hochtechnologieland wie Deutschland eher selten sind, muss man sie erfinden: Die Internetausdrucker, die Kritiker, die Spiesser, die die neue Generation behindern. Das sind junge, gut ausgebildete und verdienende Menschen, die neben Werbung vielleicht auch etwas Selbstversicherung dankbar annehmen.
Die grosse Selbstversicherung kommt vom amerikanischen Autors Jeff Jarvis, und sie ist auf dem Niveau einer Motivationsrede für angehende Internetsexabovertriebler. Jarvis erklärt Johannes Gutenberg in krasser Unkenntnis der Geschichte zum Vorläufer der Geeks und damit zum „ersten Technologieunternehmer”, was frühere Vertreter kapitalintensiver Branchen wie Bergbau und Textil und die Erbauer von Kathedralen eventuell bestritten hätten (Jarvis kommt aus einer vormals britischen und heute chinesischen Kolonie, in der viele glauben, dass die Welt in 7 Tagen erschaffen wurde, da spielen chronologische Feinheiten keine Rolle). Da war bei Wired keiner, der nach all der Dreistigkeit bei der optischen Erscheinung des Magazins noch das Fünkchen Mut hatte zu sagen: Du, Jeff, mit solchen Tschacka-Plattitüden machen wir uns lächerlich. Man hatte die Gegner definiert, man brauchte jetzt nur noch die Tradition, die man sich selbst unterstellte.

Lesbar
Zwischen diesen und anderen ideologischen Festlegungen sind die Sachthemen, soweit es sich nicht um Produktvorstellungen wie eine Lampe mit 16 Millionen Lichtfarben und eine Skibrille mit Display handelt. Es gibt im Heft, das zu mehr als zwei Dritteln von deutschen Autoren gefüllt wurde, genug Beispiele, wie man die postulierten Ansprüche eines jungen, technikbegeisterten Publiukums erfüllen kann. Es finden sich viele kreative Ideen, die mit Liebe zum Detail umgesetzt sind. Es gibt einen spielerischen Umgang mit alten Traditionen des Magazinjournalismus. Es gibt vor allem von Autorinnen Texte, die den Leser gewinnen und nicht anschreien wollen. Mitunter gelingt das auf einer halben Seite selbst mit auf den ersten Blick abseitigen Themen wie Gehörlosigkeit so gut, dass man auch vier oder fünf Seiten davon lesen möchte – nur ist dafür im deutschen Heft, im Gegensatz zum amerikanischen Original, nicht genug Platz. Es gibt Selbstironie in Wort und Bild und nette Überraschungen, wie die sehr stimmigen und amüsanten FAQs auf den letzten Seiten – etwa, wie man daheim die DNA einer Banane extrahiert. Aber die vollmundig angekündigten und über mehrere Seiten dahinplätschernden Kernstücke über Drogen, Sex und die Zukunft des Verkehrs sind weder besonders informativ noch sprachlich hinreissend, sondern platt, langweilig und belanglos: Menschen bestellen Drogen und Sexualpartner im Netz und manche überlegen, was nach dem Benzin kommt. Sensationen sehen anders aus.
Es ist daher nicht schlimm, dass Layout und Graphik, dezent wie Internetwerbung, das Lesen längerer Stücke erschweren. Mitunter hat man den Eindruck, die Buntheit von modernen Gehhilfen und Prothesen vor sich zu haben, die das Elend von Verlust und Behinderung kaschieren. Das Bunte ist die einzige echte Klammer zwischen höchst unterschiedlichen Themen, die dem Bemühen geschuldet sind, den Lesern gerecht zu werden, die technikaffin sind, aber sonst nicht viel gemein haben. Manchmal werden Augen geöffnet. Manchmal, wenn mal wieder die Gäule des digitalen Lebensstils durchgehen, schaut man betreten weg und findet, dass man der GQ Unrecht getan hat. Besonders dann, wenn bei Wired der redaktionelle Teil und die Werbung von Autobauern optisch ineinander gleiten und deren PR-Phrasen dann in einem Beitrag als „exklusiv” verkauft werden. Hier schreit Wired weniger nach Lesern denn nach Werbekunden, die von einem, höflich gesagt, angenehmen publizistischen Umfeld angetan sein könnten. Zumal auch die in wirre Graphik eingebetteten Texte oft schon beim ersten Hinsehen nicht dazu angetan sind, von all den hübschen Werbebildern abzulenken. Obwohl die Bilderflut mitunter lichte und den Text fördernde Momente hat, dominiert sie so stark, dass sogar die Versuche einer inhaltlichen Einteilung daran scheitern: Das geht bis hin zur praktischen Unlesbarkeit, weil sich die Farben von Text und Hintergrund zu wenig Kontrast bilden.
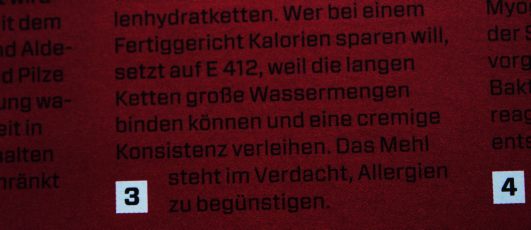
Unlesbar
In diesem Farbenbrei schwimmen dann die Artikel- und Einfallsbrocken. Manchmal ist das schade. Machmal eine Gnade.
Für Conde Nast ist Wired nach dem schmerzlichen Debakel von Vanity Fair vor allem ein weiterer Versuch, eigene Erfolgsprodukte den deutschen Verhältnissen anzupassen. Vanity Fair ist hierzulande gescheitert, weil man prollige Journalisten neureiche Promis mit dem verwechselt liess, was man wirklich als deutsche Elite bezeichnen könnte. Diesmal geht man wirtschaftlich vorsichtiger zu Werke; die Erstausgabe soll vorerst nur den Markt für das Magazin testen. Erst anhand der Reaktionen wird entschieden, ob das Projekt in Serie geht: Wer sich für „Drogen shoppen im Web” interessiert, kann sich vielleicht auch für den Kauf dieses Printprodukts erwärmen. Aber ob das reicht, eine Zielgruppe zu binden, die man mit einer Mischung aus Gejammer über Benachteiligung und Hybris der Selbstbeurteilung definiert hat, muss sich erst noch zeigen. Vielleicht versucht man es bei Wired No. 2 einfach mal mit mehr guten Texten zu ansprechenden Themen – diese Anlagen sind durchaus vorhanden.
Offenlegung: Ich kenne etliche Leute, die bei Wired mitgemacht haben, mehr oder weniger gut und/oder sie sind auch bei FAZ tätig. Ich finde, manche von denen haben eine gute Arbeit abgeliefert, und andere eher nicht.



