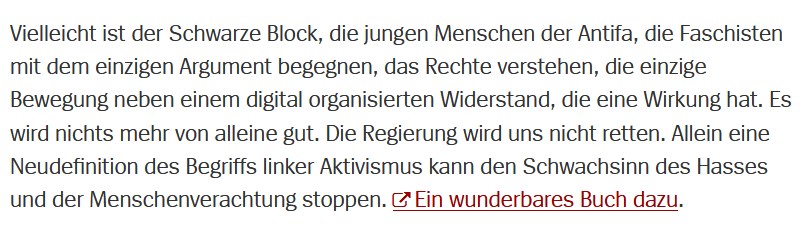Eben noch nieselte es draußen nur, jetzt prasselt der Regen an die Scheiben. November. Wenn es draußen tagsüber gar nicht mehr richtig hell wird, wenn der Wind immer kälter weht, wenn die Bäume das letzte Laub verlieren, wenn es einen nach drinnen zieht in die Wärme. Heißer Tee, Bücher, kramen in alten Briefen und Fotos, endlich mal die alte CD-Sammlung sortieren, frühere Lieblingsalben hören und dabei auch auf Stücke stoßen, die einen wieder einmal an die Endlichkeit erinnern.
Komm großer schwarzer Vogel, komm jetzt!
Schau, das Fenster ist weit offen,
Schau, ich hab’ Dir Zucker aufs Fensterbrett g’straht.
Komm großer schwarzer Vogel, komm zu mir!
Spann’ Deine weiten, sanften Flügel aus
und leg’s auf meine Fieberaugen!
Bitte, hol’ mich weg von da!
Der eigene Tod, ein Thema, das viele so gerne verdrängen und dabei wäre es doch so wichtig, das nicht zu tun, finde ich nicht erst seit Kurzem.
Wenn der österreichische Liedermacher Ludwig Hirsch mit seiner sanften Stimme den Tod heraufbeschwor, wenn er über die Todessehnsucht sang, war ich, damals gerade 20, nicht traurig, sondern fasziniert. Das hatte nichts Düsteres für mich, im Gegenteil. Irgendwo da oben im Himmel gibt es noch ein Leben, es ist nicht alles vorbei, wenn man stirbt. Man trifft sich wieder, vielleicht auf Wolke sieben, tauscht Erinnerungen aus, feiert zusammen …
Schon als Kind liebte ich Friedhöfe und schon als Teenager las ich in der Tageszeitung gerne die Todesanzeigen mit ihren Gedenksprüchen. „Alles hat seine Zeit, und jedes Ding unter der Sonne hat seine Stunde“ oder „Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines mühsam gewordenen Lebens“ – so etwas gefiel mir.
Viele, vor allem die Freunde, fanden das merkwürdig. Wir waren ja alle noch blutjung und starteten gerade erst in unser eigenes Leben, in die Zukunft. Erklären konnte ich das damals nicht, warum mich der Tod und alles, was damit zusammenhängt, schon so früh interessierte. Erst später kam mir, dass es vielleicht auch an den Beerdigungen auf dem kleinen Dorf lag, in dem meine Großeltern lebten und in dem ich als kleines Kind die langen Sommerferien verbrachte.
Der Friedhof und die Kirche mitten im Ort, das Totengeläut, die langen Trauerzüge, der Leichenschmaus nach der Beerdigung in der Dorfwirtschaft, die üppigen Speisen, die aufgetischt wurden, der Schnaps, der floss und von dem ich nippen durfte. Die Trauer und die Tränen, die sich langsam auflösten in Gelächter, wenn die lustigen und skurrilen Geschichten über die Verstorbenen erzählt und wenn gelästert und gestichelt wurde.
Nein, der Tod, der hatte und hat nichts Bedrohliches, er gehört einfach zum Leben, nicht nur an Allerheiligen und Allerseelen und am Totensonntag, wenn die Friedhöfe bevölkert sind und die Gräber mit Totengestecken geschmückt werden, weil man das halt traditionell so macht.
Bei vielen, die ich kenne, ist das Thema mit dem jährlichen Ritual abgetan, man hat der Verstorbenen gedacht und seine Pflicht getan. Für den Rest des Jahres ist der Tod nichts, worüber man spricht, außer, wenn jemand, dem man nahesteht, schwer krank ist oder stirbt.
Wenn man die Menschen aber ein wenig anstupst, reden sie doch über ihn und über ihre damit verbundenen Ängste und Sehnsüchte. Wenn ich etwa schwärme von diesen Friedhöfen in Mexiko, auf denen es keine schlichten Grabsteine gibt, sondern alles voller Plastiksachen ist, ganz gemäß dessen, was die Toten geliebt haben. Ein Meer von Autos in allen Farben, Musikinstrumente und Tanzschuhe, dazu Getränkedosen und Nachahmungen von Orangen, Süßigkeiten, Chilischoten, also all das, was die Toten im Leben geliebt und am liebsten getrunken und gegessen haben.
„Das gefällt mir“, sagte nicht nur einer, dem ich das erzählte und redeten über ihr eigene Beerdigung. Eine Seebestattung wäre schön oder ein Grab in einem Friedwald unter einem schattenspendenden Baum. Was nach ihrem Tod sein soll, wissen viele also sehr genau.
Warum aber setzen sich viele nicht mit der Zeit davor schon mitten im Leben intensiver auseinander? Vielleicht würden sie ja sogar ein glücklicheres, ein zufriedeneres Leben führen? Nur etwa 30 Prozent der Menschen würden nichts bereuen am Ende ihres Lebens, schreibt etwa die Palliativpflegerin Bronnie Ware in ihrem immer noch aktuellen Bestseller “5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen“:
- Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten.
- Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.
- Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
- Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten.
- Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt.
Nicht nur Bronnie Ware hat übrigens festgestellt, dass die Menschen gar nicht so viel Angst vor dem Moment des Sterbens an sich haben, sondern vor dem „wie“.
Wie ist das, wenn man alt und gebrechlich ist, wenn man Pflege braucht, wenn es auf das Ende zugeht? Liegt man dann alleine dement in irgendeinem Heim, in Windeln gebettet und muss gefüttert werden? Bekommt man genug Zuwendung, ist da jemand, der hilft beim Loslassen, wenn es in diese andere Welt geht oder stirbt man einsam zuhause? Hat man einen Unfall und liegt vielleicht jahrelang im Koma? Bekommt man die Diagnose „Krebs“ und kämpft jahrelang um sein Leben? Nein, leiden will niemand, allein die Vorstellung macht Angst und vielleicht ist das ja ein Grund, dass man lieber über seine Beerdigung redet als über Patientenverfügungen und Testamente.
Dabei wäre schön, wenn sich noch mehr Menschen schon in jüngeren Jahren Gedanken über die Endlichkeit machen würden und nicht erst, wenn der Tod näher rückt.
„Wie können wir uns eine Vorstellung vom Leben machen, von unserem jetzigen Leben, wenn wir nicht anerkennen, daß es irgendwann ein Ende haben wird?“. Das fragt Studs Terkel gleich zu Anfang seines Buches „Gespräche um Leben und Tod. Grenzerfahrungen, Ängste, Wünsche und Hoffnungen“. Und er stellt fast erstaunt fest, dass die im Buch versammelten Geschichtenerzähler, allesamt auf die ein oder andere Art und Weise mit dem Tod konfrontiert, kaum zu bremsen gewesen seien, wenn sie einmal angefangen hätten, zu reden.
Wenn ich könnte, würde ich das Buch, das bei mir seit Erscheinen in Deutschland im Jahr 2002 ganz vorne im Bücherregal liegt und in dem ich immer wieder gerne lese, zur Pflichtlektüre für jeden machen. Geschrieben hat es der Pulitzer-Preisträger Terkel, als er bereits fast 90 Jahre alt war. Seine Art, den Tod seine innig geliebten Frau Ida, die mit 87 starb, und den eigenen nahenden zu verkraften
Zu Wort kommen in 47 Portraits Ärzte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Notaufnahmen, Kriegsveteranen und Pfarrer, Unternehmer und Obdachlose, ein Polizist, Feuerwehrleute, eine Hiroshima-Überlebende, HIV-Infizierte, ein Mensch, der irrtümlich in der Todeszelle saß und viele mehr. Allen ist gemein, dass die Konfrontation mit dem Tod, ihre Auseinandersetzung mit ihm, ihren Blick aufs Leben verändert hat.
Der Tod gehört mit zum Leben, er sei Teil davon, erzählt etwa eine Krankenschwester. Das allerdings habe sie erst lernen müssen. Die meisten Menschen wüssten, wann ihre Zeit gekommen sei: „Ich weiß, ich muss sterben“, diesen Satz habe sie nicht nur einmal gehört. Ihre Antwort anfangs: „Wir werden alles für Dich tun, was in unsere Macht steht.“ Erst viel später änderte sich das und sie sagte: „Vielleicht stirbst Du wirklich. Aber was kann ich jetzt für Dich tun, um es Dir leichter zu machen?“
Den Tod annehmen als etwas, was eben nicht in der Macht von Menschen steht. Vielleicht ist wirklich das das Geheimnis, um sich mit ihm schon im Leben intensiver auseinandersetzen zu können und zwar nicht nur an einzelnen christlichen Feiertagen wie Allerheiligen, Allerseelen oder Totensonntag.
Bemerkenswert ist übrigens in den „Gesprächen um Leben und Tod“, dass alle irgendwann auf das Thema „Glaube“ zu sprechen kommen. „Ich bin nicht religiös, aber ich glaube an etwas Höheres“, ein Satz beispielsweise, der immer wieder vorkommt. Fest steht, dass diejenigen, die an etwas glauben, leichter mit dem Tod umgehen. Mit dem der ihnen Nahestehenden, aber auch mit dem eigenen.
Schön, zu lesen, dass es nicht nur für mich etwas Tröstliches hat, an ein Leben nach dem Tod und eine Wiedervereinigung mit großer Feier auf Wolke sieben zu glauben.