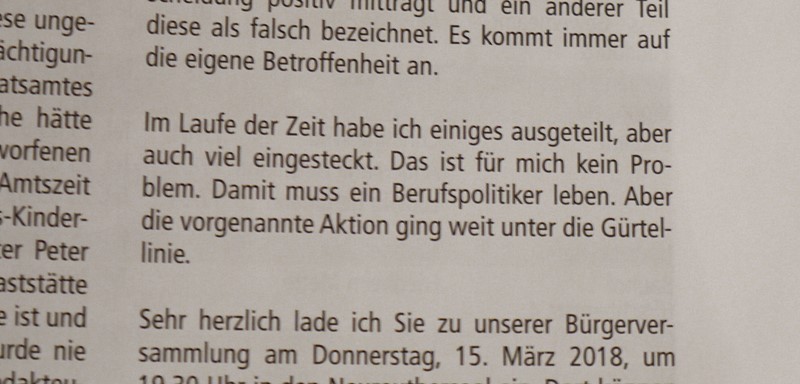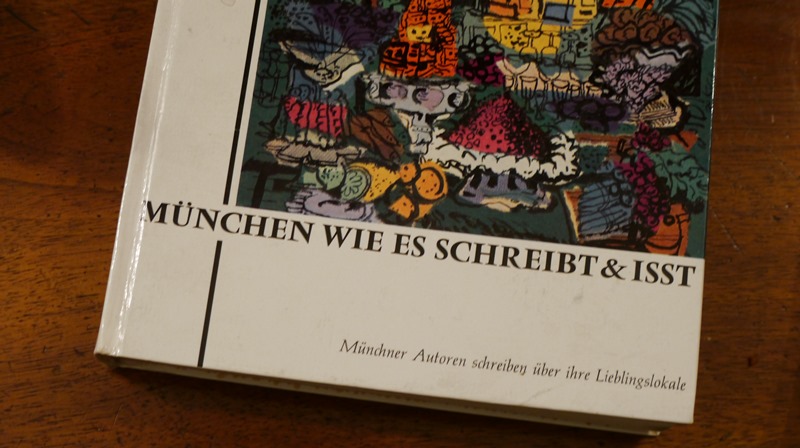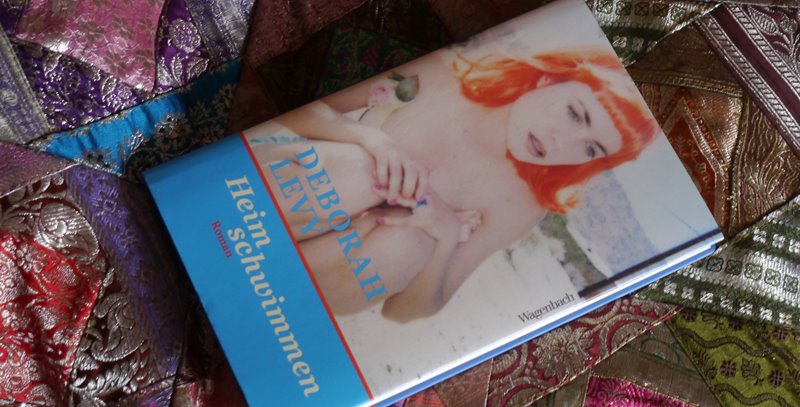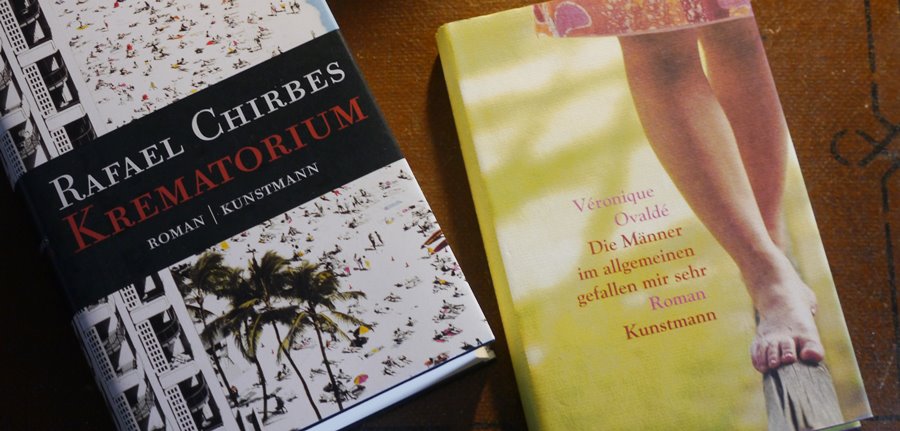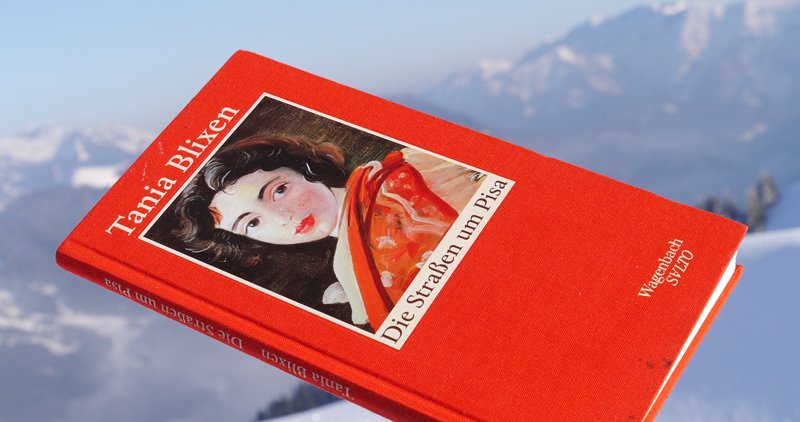You think you’re mad too unstable
Kicking in chairs and knocking down tables
In a restaurant in a West end town
Call the police there’s a mad man around
Pet Shop Boys, West End Girls
An einem kalten Januartag fuhr ich zu einem Mann, der viel Schlechtes über mich gehört hatte: Ich sei unkontrollierbar, höflich formuliert menschlich äußerst schwierig, und man würde es keine vier Wochen mit mir aushalten – dann würde ich eine brennende Lunte in die Pulverkammer werfen. Davon wusste ich nichts, aber erstens stimmte das alles aufs Wort und zweitens hatte man mir erzählt, mit dem Mann würde man es kaum aushalten, eine ganze Feuilleton-Redaktion sei vor ihm geflohen, ich sollte um Himmels Willen nicht glauben, dass er es ernst mit meinem Konzept für ein Blog über die eingebildete Oberschicht in einem bayerischen Westviertel meinen würde: Keine vier Wochen würde ich mit ihm aushalten. Nach acht Wochen wäre ich für diesen Mann barfuss durch die Hölle gegangen und hätte dafür bezahlt: Wenn er in seinem Stuhl saß, die genagelten Schuhe auf dem Tisch und die Cola neben sich, scheinbar entspannt und guter Laune, bis er einen Gedanken hörte, der neu und dreist war, um dann blitzartig wie ein Raubtier nach vorne zu schnellen – das machen wir!… Der Mann, der Nachts um drei anrief, weil er sah, dass ich noch Kommentare freischaltete und sagte, er hätte da eine Idee und wenn ich um 7 den Text schicke, geht er gleich nach vorne… Der Mann, der in Empörung baden konnte wie Siegfried im Drachenblut… der hatte am Tag vor seinem Tod noch so viele Pläne.
Und so theatralisch wie die erste Fahrt nach Frankfurt war auch dieser Dies Ater. Ich war auf dem Jaufenpass, die Sonne schien, und wie aus dem Nichts tauchte oben, als wir gerade angekommen waren ein Bergunwetter auf. Wir schossen auf den Rädern die 1150 Höhenmeter zurück ins Tal, die tiefschwarzen Wolken grollten hinter uns, und unten las ich dann die Nachricht. Meine Blogs waren mit diesem Tag vorbei, ich bot meine Kündigung an, aber der damals neue Onlinechef Mathias Müller von Blumencron wollte, dass ich trotzdem weiter schrieb. Es ging also weiter, und es wäre jetzt eigentlich vorbei, denn diesmal hat die FAZ beschlossen, diese meine Blogs nicht mehr unter ihrem Dach fortzuführen – relativ kurzfristig, mit mir sehr unangenehmen und überflüssigen Nebenwirkungen im Netz, aber auch einigen Nettigkeiten wie diverse sehr ernste Angebote, mich genau dort weiter schreiben zu lassen, wo ich hier das Blog zusperre.
Eines habe ich nicht kurz entschlossen wie damals in Januar, sondern nach reiflicher Überlegung angenommen. Die Fürsorge und Solidarität ist – für so einen kleinen, unbedeutenden Blogger und freien Mitarbeiter – sehr angenehm. Und es ist, zusammen mit dem Umstand, dass ich diesen Text in der Toskana schreibe, in einem sehr komfortablen Hotel und nach einer Radtour zu einem spannenden Thema, das nicht mehr hier laufen wird, schlichtweg keine Laune in mir, zu sagen: Aus, vorbei, das war’s. Das sagt man nicht, es stimmt auch nicht. Deshalb möchte ich hier exemplarisch über einen anderen Herren sprechen, der sich nach schicksalhaften Momenten derrappelt, den Staub des Höllenfahrt von sich abschüttelt und in die Schänke geht, um sich einen neuen Herrn zu suchen: Leporello, der faule, gefräßige, abergläubige, zynische, sexistische Diener von Don Giovanni, der schon in seiner ersten Arie losmault: Keine Ruh bei Tag und Nacht, nichts was mir noch Freude macht, schmale Kost und wenig Geld, das ertrage wem’s gefällt… und dann will er kein Diener mehr sein.
Ich mag Leporello. Er ist auf eine nette Art verdorben bis in die Knochen, man kann ihm nichts übel nehmen. Gut, er deckt den Mord seines Herrn am Komtur, aber das machen wir ja alle, er sagt aber auch Don Giovanni ins Gesicht, dass er ein Schuft ist und von den Frauen lassen sollte – und ist für vier hingeworfene Doublonen sofort wieder bereit, zum Komplizen seines Chefs zu werden. Dieser Dienstbote und Handlanger ist mindestens ein ebenso schlimmer Finger wie Chef: Nicht nur, dass er die an Frauenverachtung nicht zu überbietende Registerarie singt – dass dies Büchlein Stoff erhalte, schwärmt er bisweilen sogar für Alte – wer diese lustvolle Aufzählung einmal gehört hat, beschwert sich nie wieder über Eugen Gomringer. Nein, er macht sich in dieser Arie offensichtlich auch an Donna Elvira heran, die er mit dem Ausruf “Oh bella, Donna Elvira” begrüßt hat. Im weiteren Verlauf vergreift er sich an einem Bauernmädchen aus dem Gefolge von Zerlina und Masetto, und im zweiten Akt erzählt Don Giovanni, wie er, der Leporellos Mantel trug, von dessen Freundin begehrt wurde, Metoorello vergreift sich also selbst an hoch und niedrig geboren Frauen, und hat neben her noch eine Liebschaft laufen.
Im zweiten Akt redet er sich ein, es sei in Ordnung, seinem Herrn das Essen zu stehlen, und Don Giovanni und er loben danach zusammen den Koch und die Prasserei. Leporello hat das moralische Bewusstsein eines Einzellers, vielleicht gibt es sogar moderne Politiker, die ethischer als er agieren – und er kommt damit durch. Immer. Er bettelt im richtigen Moment um Gnade, als Don Ottavio und die anderen Moralapostel ihm. weil sie ihn für Don Giovanni halten, den Garaus machen wollen. Er denkt, er sei mit seinem Herrn verloren, als der Komtur als steinerne Statue auftaucht – aber dem geht es nur um Don Giovanni, während sich Leporello unter dem Tisch verkriecht. Man kann sagen, was man will; Der Mann hat einen phantastischen Überlebensinstinkt im Angesicht grösster Gefahr, als Don Giovanni direktemang zur Hölle fährt.
Es gibt zwei Arten von Menschen in den Opernhäusern dieser Welt: Die einen lassen sich moralisch belehren und finden die Strafe gerecht, die anderen lernen, dass man einfach nicht zu viele Leute gegen sich aufbringen sollte, das Niederstechen von Vätern vermeidet, und es in Spanien vorsichtigerweise bei 1002 Frauen belässt, bevor man an eine Scherereien machende Donna Elvira gerät – und dass man als Leporello immer wieder den Kopf aus der Schlinge zieht und aufpasst, dass es immer einen gibt, den die Hölle auf der Abholliste vor einem stehen hat. Das macht das Leben noch nicht frei von Verwicklungen, aber: Leporello ist die zweitübelste Gestalt der Oper, und hat am Ende als einziger die Freiheit.
Denn am Ende singen die Beteiligten, was sie jetzt tun werden. Donna Elvira geht ins Kloster und wird sich jede Nacht in die Arme eines Don Giovannis wünschen. Don Ottavio, der Inbegriff des besten Freundeswürstchens, das nie eine Frau abbekommt, muss mit seinen Sexwünschen, für die er Don Giovanni gemeuchelt hätte, noch ein halbes Jahr der Trauer seiner Angebeteten abwarten. Und in dieser Zeit wird Donna Anna noch ein Studium des Genderismus anfangen und ihn jeden Tag mit ihren Variationen über Judith Butler und Sabine Hark konfrontieren, und den Besuch einer Lesung mit Stefanie Sargnagel für gelungene Abendgestaltung halten. Der gewalttätige Masetto und die naive Zerlina gehen in ihr Bauernhaus, er wird sie mit seinen überzogenen Ehrbegriffen schikanieren. und sie wird sich nach ein paar Jahren fragen, warum sie sich damals im Schloss so angestellt hat: Eine Nacht mit den Giovanni wäre letztlich lustiger als ein Leben mit diesem prügelnden, eifersüchtigen Tropf. Nur Leporello packt seine Siebensachen und dazu vielleicht noch das ein oder andere, was Don Giovanni jetzt eh nicht mehr brauchen wird, und geht in die Schänke, um einen besseren Herren zu finden.
Besser, sagt er. Nicht gut, nicht ethisch, nicht wohlerzogen und keusch, kein Don Ottavio, es reicht Leporello, wenn der neue Herr etwas besser als Don Giovanni ist, der gerade zur Hölle fuhr. Leporello ist durchaus lernfähig, aber eben nur genau so weit, wie es zur Beibehaltung schlechter Moral und fragwürdiger Methoden nötig ist, und das auch nur aus Sorge um das eigene Wohlergehen. Und wie man sieht: Das reicht schon, um eine beliebte Opernfigur zu werden. Die Ansprüche des Publikums sind gar nicht so hoch, jeder kennt die streberhaften Don Ottavios, die gern in der Liebe und im Berufsleben Ethik oder Sachgründe vorschieben, um ihre eigene, schmierige Agenda zu betreiben. Leporello ist feige und egoistisch, gierig und wollüstig – bei ihm weiß man, woran man ist, und deshalb hat er vielleicht aus das beste Ende bekommen. Ein Ende, das ein neuer Anfang ist, eine Gelegenheit, ein neues Register anzulegen und dem Herrn genau das zu sagen, was man eigentlich nicht sagt. Leporello hat in etwa so niedrige Ansprüche an sein Dasein wie ich an meine Texte, mir wohnt der gleiche Widerwille inne, anderen eine Botschaft zu verkaufen, die ich gar nicht habe, und die in meinem flexiblen Dasein auch langfristig hinderlich wäre. Leporello machte am Ende alles richtig, und ich möchte dem Publikum nicht anders dienen.
Ich hoffe, ich habe Sie, liebe Leser, über all die Jahre seit der Fahrt nach Frankfurt halbwegs gut unterhalten, Sie hatten hier angenehme Gespräche, bei denen die Gedanken wild durcheinander tanzten, hier Menuette, dort Sarabanden, und fühlten sich moralisch nicht belehrt – so etwas tut man nicht, das liegt nicht in meiner Absicht, wirklich, ich wollte nie mehr tun als plaudern, und bin Frank Schirrmacher unendlich dankbar, der sagte: Das – diese unausgegorene Idee des übel beleumundeten Vogels aus Bayern, der da in sein Büro schneite – das machen wir. Einen besseren Herrn werde ich nicht finden, es war eine phantastische Zeit, ich bekam enorme Privilegien und Möglichkeiten, und – ausnahmsweise mal – ganz ehrlich: Ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und all die Anregungen und Kommentare.
Es war mir ein Vergnügen und eine Ehre, für Sie zu schreiben, und
es würde mich freuen, Sie irgendwann, demnächst in einer
anderen Schänke des Netzes zu treffen, um über
die Stützen der Gesellschaft zu
plaudern. Ihr Don
Alphonso.